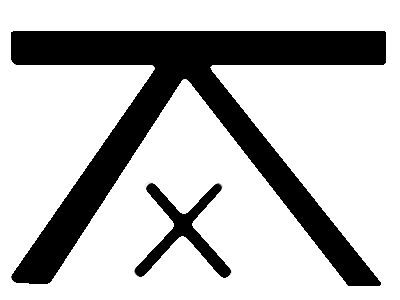Walter Tydecks
Die Kehre von Heidegger – nach Walter Schulz
Vorbereitend für den Philosophiekurs von Frau von Uffel Heideggers philosophische Grundbestimmung der Existenz als Seinsweise des Daseins im Frühjahr 2017 bei der Akademie 55plus Darmstadt wurde 2016 die von Walter Schulz 1953-54 veröffentlichte Arbeit Über den philosophiegeschichtlichen Ort Martin Heideggers verteilt. Der folgende Text von Dezember 2016 und Erweiterungen November 2018 stellt die Position von Walter Schulz in eigenen Worten dar ergänzt um einige Kommentare und weiterführende Gedanken.
Walter Schulz (1912-2000) macht sehr gut verständlich, was unter der Kehre zu verstehen ist, die Martin Heidegger (1889-1976) um 1929 vollzogen hat. Er klammert allerdings völlig die Frage aus, ob und wie das mit Heideggers Verhältnis zum Nationalsozialismus zu tun hat. (1926 erschien das umfangreiche Vorwort von Alfred Baeumler [1887-1968] zu der Bachofen-Ausgabe Der Mythus von Orient und Occident, das als der philosophische Wegbereiter des Nationalsozialismus verstanden werden kann und bis heute fast vollständig ignoriert wird. Es gab eine kurze und heftige Kontroverse von Baeumler mit dem von ihm verehrten Thomas Mann. Heidegger war von dieser Schrift tief beeindruckt und schlug Baeumler 1928 als Nachfolger für seine Stelle in Marburg vor. Baeumler wurde der wichtigste politische Philosoph des Nationalsozialismus und organisierte 1933 am Ende seiner Antrittsrede in Berlin die erste Bücherverbrennung. 1929 kam es zur berühmten Disputation von Heidegger mit Cassirer in Davos, wo Heidegger als 40-Jähriger jugendbewegt in völkischer Kleidung auftrat, und zu seinem Wechsel von Marburg zurück nach Freiburg. In diesen Jahren begann er den Völkischen Beobachter und Mein Kampf zu lesen.)
Heidegger hat aus Sicht von Walter Schulz in einem ersten Schritt das Projekt der Metaphysik bis an dessen äußerste Grenze getrieben und diese mit Sein und Zeit (1927) und dem Vortrag Was ist Metaphysik? (Antrittsvorlesung in Freiburg 1929) erreicht. Die Metaphysik fragt nach dem letzten Halt und dem inneren Zusammenhalt, auf den die Philosophie in allen ihren Disziplinen von der Begründung der Naturwissenschaft bis zur Ethik bauen kann und kommt mit Heidegger zum nicht mehr zu überbietenden Ergebnis, dass dies buchstäblich Nichts ist. Damit war einerseits eine radikale Abkehr von allen Resten mythologischen oder religiösen Denkens erfolgt, die alle im Nichts aufgelöst sind, zugleich aber auch ihr eigenes Selbstverständnis in Frage gestellt. Jeder Philosoph verstand sich als ein denkendes Subjekt, das im Innern über eine Kraft verfügt, die ihn zum Denken ermutigt und befähigt. Wenn aber im Ergebnis der Metaphysik Nichts übrig geblieben ist, gilt das auch für das Subjekt selbst. Es kann sich sowohl im Äußern wie im Innern nur noch auf Nichts berufen und muss daher den Anspruch aufgeben, es könne dank seiner Fähigkeiten die Welt verstehen und der Welt in seinem Denken ihre Regeln vorgeben. So hatte es insbesondere noch Kant gesehen, für den die Ergebnisse des Denkens nicht als Abbild der äußeren Natur, sondern als Anwendung von im Subjekt liegenden inneren Regeln zu verstehen sind (transzendentale Logik). Schopenhauer brachte das auf den Punkt: Es ist letztlich der Wille des Subjekts, der sich in seinen denkerischen Erzeugnissen zur Geltung bringt. Das alles sinkt nun am Ende der Metaphysik in Nichts zusammen. Übrig bleibt die Selbstbescheidung, dass das Subjekt nicht von sich aus die Natur zunächst im Denken unter ihre Regeln bringen und dann in der daraus folgenden Praxis dominieren und unterwerfen kann, sondern umgekehrt auf das Sein zu hören und die Geschicke des Seins zu verstehen und ihnen zu folgen hat. Diese Wende vom Nichts zur Anerkennung des Seins versteht Schulz als die Kehre im Denken von Heidegger. Das Subjekt muss in ein neues Verhältnis zur Welt treten und ihr nicht mehr seine Logik vorschreiben, sondern auf deren Sprache lauschen und sie in Worte fassen. Hier zeichnet sich für Heidegger die Gründung einer neuen Epoche ab.
Schulz geht jedoch nicht mit Heidegger zu den Anfängen der Metaphysik bei Aristoteles zurück, zu dem Heidegger mit seinen Kommentaren einen völlig neuen Zugang geöffnet und von dort ausgehend zu seiner eigenen Philosophie gefunden hatte. Seit Aristoteles hatte die Philosophie versucht, Fragen philosophisch zu klären, die zuvor ausschließlich religiös oder mythisch beantwortet worden waren. Das war insbesondere die Frage nach der Unendlichkeit. Für Mythos, Religion und Theologie kann nur Gott (oder ein Höheres Wesen, oder das Absolute) unendlich sein. Aristoteles öffnete mit seiner Lehre der potentiellen und aktualen Unendlichkeit einen neuen Ansatz, der bis heute gültig und tragfähig ist (siehe nicht zuletzt Hegel und Cantor, die sich beide in unterschiedlicher Weise darauf beziehen). Bei ihm blieb jedoch das Verhältnis von Philosophie und Glauben an ein Höheres Wesen ausgewogen. Das änderte sich erst, als mit der Neuzeit sowohl neue experimentelle Methoden wie verbesserte formale Darstellungsmöglichkeiten gefunden wurden, die in enger Zusammenarbeit von Philosophie, Mathematik und den Realwissenschaften entstanden. Vor allem sind Newton, Leibniz, Kant, Hegel, Cantor und Gödel zu nennen. Seither ist die große Mehrheit der Naturwissenschaftler überzeugt, auf Gott ganz verzichten zu können, obwohl gerade Cantor und Gödel tief gläubig waren. Hannah Arendt schrieb zu dieser neuen Entwicklung: »Schon in diesen bereits atemberaubenden Anfängen der modernen Mathematik (bei Newton, t.) war das erstaunliche menschliche Vermögen entdeckt, vermöge einer abstrakten Symbolsprache sich der Dimensionen und Horizonte zu bemächtigen, die für alle früheren Zeiten Grenzphänomene waren, von denen man sich bestenfalls im Begriff der Negation und Negativität eine Vorstellung machen konnte.« (Arendt Vita activa, S. 259)
Dagegen konzentriert sich Schulz auf eine andere Tradition, die für ihn ebenfalls erst mit der Neuzeit beginnt. Die Philosophen werden sich zunehmend bewusst, dass die Menschen in ihrem Denken nicht einfach aufzeichnen, was sie vorfinden, sondern dass in ihrem Denken Vorannahmen enthalten sind, mit denen alles vorgeprägt wird, was sie denken. (Dafür haben sich heute weitgehend die Ausdrücke ‘präreflexiv’ und ‘vorgängig’ durchgesetzt.) Das ist für Schulz noch vor der transzendentalen Logik oder Reflexionslogik die Frage nach der Subjektivität: Es sind nicht nur Subjekte, die etwas denken, sondern das Denken enthält eine innere Subjektivität, mit der es an alles herangeht und in gewisser Weise alles nur so sieht, wie es seinem eigenen Vorstellungsvermögen und den von ihm benutzten Denk-Schemata entspricht. Elementare Beispiele: Das Denken kann die Dinge nur aus der Distanz – in der Reflexion, wie Locke sagt – und nicht im unmittelbaren Handgemenge erkennen, und es verdankt seine Fortschritte seiner Fähigkeit, an allem bloßen Augenschein zu zweifeln und ihn zu hinterfragen (so Descartes). Distanziertheit (Reflexivität) und Zweifel (Skeptizismus) sind subjektive Eigenschaften, die jedem so selbstverständlich erscheinen, dass niemand darüber nachdachte, ob sie möglicherweise wie eine Brille wirken, durch die alles in bestimmter Weise »eingestellt« und nur in dieser Perspektive gesehen wird. Diese Frage beschäftigt seither die Philosophie. Wie würde zum Beispiel ein Denken aussehen, dass ganz ohne jeden Skeptizismus auskommt und alles in seiner Unschuld zu verstehen vermag (wonach sich Nietzsche sehnte)? Und kann es ein Prozessdenken geben, dass nicht nur über Prozesse denkt und den Dingen seine Modelle gegenüberstellt, sondern im Fluss entsteht und die Distanziertheit und Reflexivität abwirft? Entsprechende Ansätze lassen sich zum Beispiel bei Heraklit und im chinesischen Denken erkennen (Taoismus) und haben Heidegger fasziniert.
Für mich geht die von Schulz gemeinte Subjektivität weit über die Neuzeit hinaus auf die jüdisch-christliche Tradition zurück. Diese lehrt, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde und als solches die Natur erkennen, für sich nutzbar machen und unterwerfen kann. Von dieser Vorstellung ging die neuzeitliche (westliche) Philosophie aus, wobei sie sich jedoch schrittweise von der religiösen Wurzel löste. Durch Selbstbeobachtung erkannte die Philosophie immer besser, wie die Fähigkeiten des Menschen rein aus ihrer eigenen Tätigkeit von innen her zu beschreiben und zu verstehen sind, ohne sich auf einen göttlichen Auftrag zu berufen. Damit sind nicht in erster Linie technische (mehr oder weniger handwerkliche und schematisch zu erlernende) Fähigkeiten und Schulwissen gemeint wie zum Beispiel die Fähigkeit logisch zu denken, Experimente auszuführen und aus ihnen zu lernen, Systeme zu bauen und durch neue zu ersetzen, sondern tiefergehend die Fähigkeit, überhaupt Werke solcher Art angehen und für sie einen Anfang finden zu können, die Kreativität und Produktivität des Menschen. In der jüdisch-christlichen Tradition war das eine dem Menschen von Gott verliehene Fähigkeit, mit ihm in Beziehung treten zu können und im Zwiegespräch mit Gott die erforderliche innere Freiheit und Kraft zu gewinnen, um eigene Werke entwerfen, planen und ausführen zu können. Der »Gründungsakt« hierfür war die Begegnung von Moses mit Gott auf dem Berg Sinai. Was bei einer solchen Offenbarung geschieht, ist alles andere als ein Coaching oder Schulbesuch. Der Mensch erlebte Erschütterungen und Krisen durch Gott, die ihn so weit aus der gewöhnlichen Bahn warfen, bis er den Horizont übersehen lernte, in dem die gewohnten Verhaltens- und Lebensweisen seines Alltags eingeschrieben sind, und andere Wege sichtbar und greifbar werden. In einer solchen Krise ist der Mensch in eine Position gebracht, in der er sich dem eigenen Selbstbild, der Welt und der gesamten ihm verfügbaren Geschichte gegenüber sieht. (Ein anderes Beispiel ist das Buch Hiob, auf das sich fast alle existenzialistischen Denker und Theologen berufen bis hin zu Psychologen wie C.G. Jung.) Es ist der große Gedanke von Heidegger, dass Erschütterungen dieser Art die vorgängige und präreflexive Voraussetzung sind, damit überhaupt eine Stellung des Menschen zur Natur möglich wird, wie sie sich in der Naturwissenschaft oder Ethik äußert, und die Beschreibung einer solchen Erschütterung aus dem religiösen Kontext zu lösen und rein philosophisch (existenzialanalytisch) zu formulieren. Statt der persönlichen Begegnung mit Gott denkt er an Bilder wie »wenn in der Kehre der Gefahr die Wahrheit des Seins blitzt« (Heidegger 1962, 43). Gott als Blitz zu verstehen ist typisch für frühe Religionen und wurde bereits von Heraklit philosophisch gedeutet: »Das Weltall aber steuert der Blitz.« (ta de panta oiakizei keraunos) (Heraklit, Fragment 64) Heidegger hat dies Fragment als Sinnspruch an seiner Hütte in Todtnauberg angebracht.
Das gilt nach meiner Erfahrung auch für die Naturwissenschaftler. Zwar unterscheiden sich ihre wissenschaftlichen Methoden vom Denken der Philosophen und Visionäre. Von den meisten Menschen werden Naturwissenschaftler, Ingenieure, Mathematiker oder Informatiker als sachlich und gewissenhaft arbeitende Menschen erlebt. In ihren Äußerungen bleiben sie ganz bei einer formalen und mathematischen Darstellungsweise, weil sich für sie darin die Sache am besten und objektivsten treffen lässt. Heidegger bringt es in einer bewusst doppeldeutigen Formulierung, – die jeden Naturwissenschaftler vor den Kopf stoßen muß –, auf den Punkt, »dass die Wissenschaft ihrerseits nicht denkt und nicht denken kann und zwar zu ihrem Glück und das heißt hier zur Sicherung ihres eigenen festgelegten Ganges« (Heidegger, Was heißt Denken?, S. 8) Um aber dahin gelangen zu können, bedarf die Wissenschaft nicht nur der Denker, die ihre Grundlagenbegriffe wie z.B. Raum, Zeit oder Bewegung aufklären (wie Heidegger in einem Interview erläutert hat, YouTube), sondern jeder Naturwissenschaftler hat in seinem Leben eine Erfahrung gemacht, die ihn zutiefst erschütterte, ihm ein Gesamtbild der Welt gab und ihn auf den Weg brachte, sich auf den Gang der Naturwissenschaft begeben zu können. Das von Heidegger genannte Glück hat für mich daher zwei Seiten: Es ist für sie ein Glück, dass die Wissenschaft über Methoden verfügt, anders als mit der Philosophie ihre Erkenntnisse zu finden und zu sichern. Sie braucht sich nicht wie die Philosophie ständig des eigenen Vorgehens zu versichern, sondern verfügt über eine innere Sicherheit, dank ihrer Methode objektiv sein zu können. Heidegger hat das nie infrage gestellt, sondern sich gefragt, wie das möglich ist. Er hat im Innern der Technik und Naturwissenschaft nach der besonderen Weise gesucht, wie dort das Sein den Menschen anzusprechen und dieser darauf zu antworten vermag, wenn er in dieser Sicherheit geduldig und erfolgreich forschen kann und sich nicht einmal die skeptische Frage stellt und stellen muss, wie das möglich ist. Wenn das gelingt, erfährt jeder Naturwissenschaftler in seiner Arbeit ein Glücksgefühl, das ihn bestätigt und ihm die Kraft gibt, in der Objektivität seiner Arbeit der ursprünglichen Erfahrung der Erschütterung treu zu bleiben und ihr gerecht zu werden. Und doch ist unverkennbar, dass diese Art von Glück bei Heidegger einen ironischen, wenn nicht zynischen Unterton hat. In ihren praktischen Erfolgen gibt sich die Naturwissenschat mit einem Glück zufrieden, das Heidegger für sich persönlich sicher nicht teilt. Im Gegenteil lässt er in Die Technik und die Kehre keinen Zweifel, dass diese Art von Glück, die sich ausschließlich am technischen Gelingen erfreut und weder nach rechts noch nach links schaut, was ihre Ergebnisse in der Welt anrichten, für ihn die größte Gefahr darstellt, der die Menschheit seit der Neuzeit ausgesetzt ist.
Und doch räumt er ein, dass auch der naturwissenschaftlichen Haltung (von Denken möchte er nicht sprechen) eine existenziale Erfahrung des Seins vorausgeht. Dies zu erkennen ist für ihn die Hoffnung, dass es zu einer Kehre im engeren Sinn kommen kann, womit in diesem Zusammenhang eine Kehre von der wissenschaftlichen zur philosophischen Forschung gemeint ist. Er hofft, dass ein Wissenschaftler, der einmal eine Erschütterung dieser Art erlebt hat, dank derer er wissenschaftlich arbeiten kann, auch einer zweiten Erschütterung fähig ist, die ihm im Ganzen zeigt, welchen Weg er eingeschlagen hat und zur Umkehr bewegt. Denn dass es Erschütterungen solcher Art gibt, weiß und erlebt jeder, doch werden sie in sehr unterschiedlicher Weise gedeutet. Sie können bei den Betroffenen und oft noch mehr bei Außenstehenden Angst und Scheu auslösen (vielleicht auch Neid vor dem Glück Anderer, die so etwas erleben können) und werden dann in Abwehr dagegen auf einen unbedeutenden Reflex oder ein pathologisches Ereignis reduziert, ein Fall für den Psychiater oder den Verhaltensforscher. Zur Zeit von Heidegger waren viel diskutierte Beispiele die Lehre vom Pawlowschen Hund oder mehr oder weniger statistische Beschreibungen wie in der Verhaltenspsychologie und dem Behaviorismus. Ihnen folgten die Neurophysiologie, Endokrinologie (Lehre von Hormonen) usw. Diese Deutungen sind nicht einfach falsch, aber sie verwechseln Grund und Möglichkeit. Für Heidegger sind Erschütterungen, die früher der religiösen Sphäre zugeschrieben wurden, der einzige Grund, aus dem heraus erst wissenschaftliches Arbeiten möglich wird. Bei Aristoteles fand er im ersten Buch von dessen Metaphysik eine Beschreibung, die für ihn die Ablösung von der jüdisch-christlichen Tradition möglich machte. Aristoteles spricht von der elementaren Fähigkeit des Verwunderns (thaumazein). Im Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Eisler (1904) sind die wesentlichen Stellen zusammengestellt (bei Aristoteles Metaphysik Buch 1, Kapitel 2, Zeile 982b11). Das ist seit Aristoteles der Gründungsakt der empirischen Forschung und der Naturwissenschaft. Jeder Naturwissenschaftler wird das bestätigen, hält es aber in der Regel nicht für notwendig, sich weiter darüber Gedanken zu machen. Heidegger übersetzte in seiner frühen phänomenologischen Interpretation von Aristoteles in Freiburg 1922 das Wort thaumazein mit einer bewusst verfremdenden und zugleich unübertrefflich gelingenden Formel: »Das umsehende Haben eines Begegnenden als Befremdenden ist die Weise des Verwundertseins.« (Heidegger 1922a, S. 94f) Das ist für mich der Ausgangspunkt der Heideggerschen Philosophie. Mit der Kehre von 1929 kehrt er in gewisser Weise dorthin zurück, und zugleich blitzt für mich in dieser Formulierung auf, welche Faszination die Wissenschaften trotz allem auf Heidegger ausübt, die ohne Zweifel von einem thaumazein dieser Art getragen ist und es in ihre Erkenntnisse und Darstellungsweisen umzusetzen vermag.
Heidegger blieb nicht dabei stehen, einer rein oberflächlichen Haltung vorzuwerfen, dass sie am liebsten alle Erschütterungen verleugnen, vermeiden, zumindest nicht darüber reden und durch geeignete Behandlungsmethoden zurechtstutzen und ruhigstellen möchte. In seiner radikalen Religionskritik sieht er sich weit entfernt von dem heute üblich gewordenen Überlegenheitsgefühl des modernen Menschen gegenüber denjenigen, die noch in Magie oder Religion befangen sind. Im Grunde fühlt er sich denen mehr verbunden, die immerhin überhaupt noch eine radikale Infragestellung ihres gewöhnlichen Lebens im Gespräch mit Gott suchen, als denen, die sich völlig im Diesseits eingerichtet haben. Hatte er anfangs nur verstehen wollen, welche existenziale Grunderfahrung jeder Naturwissenschaft vorausgeht, auch wenn sie das nicht wahrhaben will oder einfach nicht darüber sprechen kann oder will, sieht er schließlich in dieser Haltung so etwas wie den Nihilismus unserer Epoche, dem er den Kampf ansagt. In einer ungeheuren Radikalisierung sieht er eine Art Entscheidungskampf zwischen der für ihn rein be-rechnend gewordenen, wissenschaftlichen Herangehensweise (die er übergreifend mit dem romanischen, jüdischen, rechnenden, amerikanischen oder bolschewistischem Denken identifiziert, die für ihn alle nur unterschiedliche Ausprägungen dieser Haltung sind) und der von ihm vertretenen philosophischen Herangehensweise. Am Wendepunkt des 2. Weltkriegs deutet er 1943-44 das militärische Geschehen als eine existenziale Katastrophe. »Der Planet steht in Flammen. Das Wesen des Menschen ist aus den Fugen. Nur von den Deutschen kann, gesetzt, daß sie ›das Deutsche‹ finden und wahren, die weltgeschichtliche Besinnung kommen. Das ist nicht Anmaßung, wohl aber ist es das Wissen von der Notwendigkeit des Austrages einer anfänglichen Not.« (Heidegger 1943-44, S. 123). Da es buchstäblich um Alles geht (die Negation des metaphysischen Nichts), sind auch alle Mittel erlaubt. Diese extreme Konsequenz ist nur möglich, wenn die Metaphysik bis an die Grenzfrage des Nichts getrieben ist (im wörtlichen Sinn Nihilismus). Schulz bleibt jedoch dabei stehen, den Gedanken von Heidegger aus sich als eine Art rein philosophisches Gedankenexperiment zu sehen ohne den Horizont, in den Heidegger sein Denken sehr bewusst nach 1933 stellte und davon später nie wieder ausdrücklich Distanz nahm.
Wie konnte es zu einer solchen Radikalisierung kommen? Heidegger hatte schon 1922 in dem sogenannten Natorp-Bericht geschrieben: »Dieser Hang zur Besorgnis ist der Ausdruck einer faktischen Grundtendenz des Lebens zum Abfallen von sich selbst und darin zum Verfallen an die Welt und hierin zum Zerfall seiner selbst. [...] Dieser Hang ist das innerste Verhängnis, an dem das Leben faktisch trägt.« (Heidegger 1922b, 19) Der Gedanke geht zurück auf manichäisches, gnostisches Denken, wie es insbesondere von Schelling in seiner Freiheits-Schrift von 1809 aktualisiert und von Heidegger übernommen wurde. Die Verkehrung, was Glück für die nicht-denkende Naturwissenschaft ist, ist für mich ein Beispiel des Verhängnisses, das Heidegger meint. Bei aller Begeisterung für Aristoteles, scheint mir letztlich Schelling für das Denken von Heidegger bestimmend gewesen zu sein. Walter Schulz scheint es ähnlich gesehen zu haben. Er hat sich 1951 mit einer Arbeit habilitiert, die den programmatischen Titel trägt: Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings. Sie erschien 1955 und gilt als sein Hauptwerk.
Der wichtigste Vorläufer des existenzialen Denkens von Heidegger ist Kierkegaard, der als erster in ähnlicher Weise versucht hat, religiöse Verhaltensweisen und Stimmungen philosophisch zu fassen. Das sind vor allem seine Schriften Der Begriff Angst und Die Krankheit zum Tode, womit er eine Art von religiöser Verzweiflung meint. Zwar bezieht er sich anders als Heidegger noch ausdrücklich auf die christliche Tradition, doch beschreibt er sie bereits völlig aus Sicht des Menschen. Heidegger führt das mit seinen Ausführungen zur Sorge und dem Bewußtsein der eigenen Sterblichkeit fort.
Für Heidegger zeigt sich an Verhaltensweisen wie Angst oder Bewußtsein um die eigene Sterblichkeit zweierlei: Der Mensch versteht, dass er in seinem Dasein nicht einfach etwas Vorhandenes ist, eine »Fabrikware« (Schopenhauer) oder ein ausschließlich in seinen Instinkten und Überlebenswillen lebendes Tier, sondern dass er fähig ist, sich über sein Leben zu erheben und dieses in seiner Gesamtheit zu verstehen zu versuchen. Das war dem Menschen traditionell nur im Gespräch (Gebet) mit Gott möglich, wenn er sich ganz aus seinem Alltag zu entfernen vermochte und in Gott einen Rückhalt fand, der fern von allen Alltagssorgen liegt und ihm rückkehrend aus der Erfahrung der Nähe Gottes ermöglichte, in den Sorgen des Alltags eine Haltung zu finden, die ihn nicht verzweifeln lässt. Diese religiöse Erfahrung möchte Heidegger unabhängig von Religion und Gott in rein philosophische Begriffe fassen. – Und während das Tier ganz in der Zeit lebt und die Götter unsterblich sind, ist nur der Mensch fähig zu einem Verständnis der Zeitlichkeit, durch die sein Dasein geprägt ist.
Heidegger konnte vor allem von Kant, Husserl und Kierkegaard ausgehen. Kant hatte für die Frage nach der Subjektivität des Denkens die richtige Bahn gefunden, als er erkannte, dass die Wissenschaften nur im Horizont der Zeit denken können. Für ihn war die Zeit mit ihren Eigenschaften (Dauer, Kausalität, Wechselwirkung) das Schema, von dem ausgehend wissenschaftliches Denken möglich ist. Heidegger ging einen Schritt weiter, als er fragte, wie der Mensch überhaupt dazu kommen kann, in einer Weise wie Kant über die Zeit nachdenken zu können. Das ergibt sich für ihn aus der Zeitlichkeit, durch die das Dasein des Menschen geprägt ist. Wer keine Sorge und kein Bewußtsein der eigenen Sterblichkeit kennt, ist für Heidegger nicht in der Lage, überhaupt irgend einen Begriff der Zeit entwerfen zu können. Und nur wer das kann, vermag darauf aufbauend Wissenschaft zu betreiben.
Husserl hatte über Kant hinaus nach der Intersubjektivität gefragt. Jeder Wissenschaft und jeder Ethik geht die Fähigkeit voraus, sich intentional auf etwas beziehen und jemandem Aufmerksamkeit widmen (schenken) zu können. Damit war Husserl bereits weit über die klassische Subjektivität hinausgegangen. Sie beschränkt sich nicht mehr darum, dass es überhaupt ein Subjekt gibt, das zu handeln und zu denken vermag, sondern die Subjekte sind fähig, sich aufeinander zu beziehen. Wie gegenüber Kant fragte Heidegger auch gegenüber Husserl, ob der Intentionalität ein Wesenszug im Dasein zugrunde liegt, der denjenigen, die sich in einem solchem Dasein befinden, Intentionalität ermöglicht. Dafür fand er den Ausdruck ‘Zuhandenheit’. Nur weil es im Dasein Zuhandenes (und nicht bloß Vorhandenes) gibt, kann es Intentionalität und Intersubjektivität entwickeln. Zuhandenheit und Zeitlichkeit sind die beiden Grundzüge des Daseins, um die es Heidegger in Sein und Zeit geht.
Schulz sieht Heideggers Gedanken der Zuhandenheit bei Kierkegaard und Marx vorgeprägt. In seinem Werk über die Verzweiflung schreibt Kierkegaard: »Der Mensch ist Geist. Was aber ist Geist? Der Geist ist das Selbst. Was aber ist das Selbst? Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder ist dasjenige am Verhältnis, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält; das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Der Mensch ist eine Synthese von Unendlichkeit und Endlichkeit, von Zeitlichem und Ewigem, von Freiheit und Notwendigkeit.« (Kierkegaard Krankheit zum Tode, S. 13). Auf ähnliche Weise spricht nach Schulz Marx vom sich selbst herstellenden Wesen (Schulz 1953-54, S. 99). Sowohl Kierkegaard wie Marx versuchen, den Menschen aus sich selbst heraus zu verstehen. Schulz verallgemeinert das zum »Zusichkommen des Geistes« (Schulz 1953-54, S. 100) und sieht das auch bei Hegel, wenn der im Einzelnen ausführt, wie der Geist sowohl in der Erkenntnis seiner selbst wie in der Erkenntnis des menschlichen Lebens und der Natur sich selbst erkennen kann und zu sich kommt. »Schelling und Kierkegaard versuchen gleichwohl, das Daß dieses Subjekts noch theologisch auf Gott zurückzuführen. Heidegger dagegen nimmt dieses Daß in die Bestimmungen des Daseins selbst mit hinein.« (Schulz 1953-54, S. 102)
Alles bisher Gesagte wird in gewisser Weise noch einmal wiederholt: In Sein und Zeit führt für Heidegger »die Überschreitung nicht etwa auf Gott hin, sondern in das Nichts« (Schulz 1953-54, S. 107). Der Mensch erlebt und erfährt heute wie in Vorzeiten, dass er aus sich selbst heraus die Erfahrung macht, dass es etwas anderes gibt als ihn selbst. Aber es gibt für ihn keinen Grund mehr, das Andere in einem fernen Gott zu sehen, sondern es ist letztlich Nichts. Wenn der Mensch erleben muss, dass es da außerhalb seiner keinen Gott gibt, auf den er sich verlassen und beziehen kann, dann tritt an die Stelle Gottes das Nichts, von dem sich der Mensch umgeben fühlt. Er deutet seine existentiellen Gefühle wie Erschütterung, Sorge oder Verzweiflung nicht mehr als Anstoß durch Gott, sondern durch die Erfahrung, dass es Nichts gibt. Heidegger bezeichnet diese paradoxe Erfahrung als »Hineingehaltenheit in das Nichts« oder »Platzhalter des Nichts« (Schulz 1953-54, S. 109). So »kommt das Dasein nicht bei einem seienden Gott an, sondern wird ins Nichts hineingehalten« (Schulz 1953-54, S. 110). Der Mensch wird für Heidegger nicht mehr erschüttert durch die Nähe Gottes, sondern durch das Fehlen einer Nähe Gottes, durch das Nichts.
Damit ist der äußerste Punkt erreicht, an den die Metaphysik gelangen konnte. Sie hat alle Versuche aufgegeben, irgendetwas auf Gott oder ein anderes Transzendentes zurückzuführen, und übrig bleibt buchstäblich nur Nichts. Schulz erwähnt nicht, dass Kierkegaard auch dies Paradox bereits bewusst war. »Und so ist es auch des Verstandes höchste Leidenschaft, den Anstoß zu wollen, obgleich der Anstoß auf die eine oder andere Art sein Untergang werden muß. Dies ist also das höchste Paradox des Denkens, etwas zu entdecken, was es selbst nicht denken kann.« (Kierkegaard Philosophische Brocken, S. 36) Während jedoch für Kierkegaard diese Leidenschaft ihrerseits eine Art von Erschütterung ist, die den Menschen und seinen Verstand erbeben lässt und ihn dazu führen kann, die religiöse Sphäre zu verstehen und anzuerkennen, bleibt Heidegger bis zu seiner Kehre bei der Beschreibung dieses Paradoxes stehen. Das Einzige, was der Mensch kennt, ist die bloße Faktizität (Gegebenheit) einer solchen Erfahrung.
An diesem Punkt kommt es bei Heidegger zur Kehre. Während Kierkegaard nahelegt, dass ein verzweifelter Mensch zur Bekehrung zu Gott gelangen kann, sucht Heidegger auch für die religiöse Erfahrung der Bekehrung eine Deutung, die vollständig im eigenen Dasein verbleibt und keinerlei Anstoß von außen sieht. Die Kehre ist nicht einfach eine Wende, die Heidegger denkend vollzogen hat, sondern vergleichbar der Sorge oder der Angst ein existenzielles Verhalten, das der Mensch erlebt. Diese Einsicht übergeht Schulz, aber er legt sie nahe, wenn er klarer als andere mir bekannte Autoren beschreibt, worin aus seiner Sicht die Kehre bei Heidegger besteht: »Der Mensch ist nicht mehr Platzhalter des Nichts, sondern Hirte des Seins, 'an die Stelle' der Angst tritt die Freude für die Huld des Seins, das Nichts selbst wird als das Sein bestimmt.« (Schulz 1953-54, S. 110) »Ich will mich nicht mehr begründen, sondern nehme mich hin als 'ausgesetzt' vom Sein.« (Schulz 1953-54, S. 111)
Schulz kommt einem Verständnis sehr nahe, dass die Kehre als ein eigenes Existenzial sieht. »Er setzt nicht nur das Sich-nicht-anhalten beim Seienden, sondern auch das Sich-nicht-versteifen in seiner Ohnmacht voraus. Es erfordert wirklich, daß das Subjekt sich in seiner Vormachtstellung aufgibt.« (Schulz 1953-54, S. 116) Das verstehe ich so: Schon die jüdisch-christliche Tradition hatte vom Menschen erwartet, sich an keine gegebenen Dinge zu klammern, siehe die Kritik an den Baals-Kulten, die Vergötterung irdischer Werte wie Gold, Reichtum oder Ruhm. Heidegger radikalisiert das, wenn er sagt, dass sich das metaphysische Denken auch an keinerlei Götter halten darf, die ihrerseits wiederum wie Seiendes vorgestellt werden, an das sich der Mensch in seiner Not halten will. »Denn auch der Gott ist, wenn er ist, ein Seiender, steht als Seiender im Sein und dessen Wesen.« (Heidegger 1962, 45) Er wendet die von der jüdisch-christlichen Tradition vorgegebene Kritik an allen irdischen Werten gewissermaßen gegen diese selbst, indem er sowohl den Glauben wie alle Götter ebenfalls als Beispiele irdischen Denkens versteht. Hatte Kant noch gesagt, dass Gott nur negativ verstanden werden kann, radikalisiert Heidegger das dahin, dass sich das Denken letztlich nur auf Nichts berufen kann.
Doch diese Einsicht reicht ihm nicht aus. Es droht, dass sich das Denken in dieser negativen Haltung versteift und in gewisser Weise einrichtet. Es droht, daraus eine Art von moralischem Nihilismus abzuleiten: Wenn es keinen Gott, sondern nur Nichts gibt, dann ist alles erlaubt. Auch dagegen wendet sich Heidegger in seiner Kehre. Die nihilistische Parole ›alles ist erlaubt‹ verleiht dem Subjekt für einen Moment den höchsten Triumph: Es fühlt sich frei, jetzt alles tun zu dürfen, was ihm beliebt, und an Nichts gebunden zu sein. Diese Tendenz sieht Heidegger in unserer Zeit gegeben, und sie hängt für ihn zusammen mit der von ihm kritisierten rein wissenschaftlichen Erklärung des menschlichen Verhaltens. Die Kehre wendet sich dagegen: Statt nun auf dem Höhepunkt der Metaphysik das Subjekt triumphieren zu lassen, ergibt sich für Heidegger umgekehrt die Einsicht, dass eine ganz neue Art von Bescheidenheit zu erreichen ist. Schulz genügt es, diesen Gedanken zu erkennen. Für mich ist auf den ersten Blick unerklärlich, warum Heidegger für die Kehre im deutschen Volk einen nationalen Träger sucht und überzeugt ist, dass sich das deutsche Volk dieser Aufgabe zumindest für einen Moment bewusst war, als es 1933 dem Nationalsozialismus zur Macht verhalf. Es scheint, dass seine Metaphysik doch nicht so radikal an die Grenze getrieben war, wie es Schulz vermutet. Heidegger selbst scheint der Meinung zu sein, dass seine Radikalisierung der Metaphysik nicht ohne Grund nur in der deutschen Sprache und hier insbesondere in seinem ungewöhnlichen Gebrauch dieser Sprache erfolgen kann. So erreicht er entgegen seiner eigenen Aussage keineswegs das Nichts, sondern er erreicht sein Verständnis der deutschen Sprache. Wer dieser Sprache mächtig ist, ist für ihn berufen, das Schicksal (oder in seiner Ausdrucksweise, das vom Sein Geschickte) zu ergreifen und selbst bei allen Opfern und im Scheitern (im Untergang) zum wahren Menschentum zu finden, das denen verschlossen bleibt, für die eine solche Sprache bloßes Wortgeklingel ist. Für Carnap, der 1929 Augenzeuge des Treffens von Heidegger mit Cassirer war, sind Sätze wie »das Nichts selbst nichtet« (Heidegger 1929, S. 114) aus Was ist Metaphysik? schlicht »sinnlose Wortreihen« oder »metaphysische Scheinsätze«.
Literatur
Hannah Arendt: Vita activa, München u.a. 1987
Rudolf Carnap: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache
in: Erkenntnis 2. 1931, 219-241
Frank Edler: Alfred Baeumler on Hölderlin and the Greeks: Reflections on the Heidegger-Baeumler Relationship, Omaha, Nebraska 2002
Martin Heidegger 1922a: Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur Ontologie und Logik, Frankfurt am Main 2005 (Gesamtausgabe Bd. 62, Freiburger Vorlesung Sommersemester 1922
Martin Heidegger 1922b: Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Natorp-Bericht), Stuttgart 2003 [1922]
Martin Heidegger 1927: Sein und Zeit, Tübingen 1977
Martin Heidegger 1929: Was ist Metaphysik?
in: ders.: Wegmarken, Frankfurt am Main 1967, S. 103-122
Martin Heidegger 1943-44: Heraklit, Vorlesung 1943-1944, Frankfurt 1979 (Gesamtausgabe Bd. 55)
Martin Heidegger 1951-52: Was heißt Denken? Vorlesung Wintersemester 1951-52, Stuttgart 2001 (Reclam-Ausgabe)
Martin Heidegeger 1962: Die Technik und die Kehre, Pfullingen 1982 [1962]
Sören Kierkegaard: Der Begriff Angst, Frankfurt 1984
Sören Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode, Frankfurt 1984
Sören Kierkegaard: Philosophische Brocken, Frankfurt 1984
Walter Schulz 1953-54: Über den philosophiegeschichtlichen Ort Martin Heideggers
in: Otto Pöggeler (Hg.): Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werks, 1984, S. 95-139
zuerst in: Philosophische Rundschau, 1. Jg., 1953/54, S. 65-93 und 211-232
Walter Schulz 1989: Die Aufhebung der Metaphysik in Heideggers Denken
in: Marcel F. Fresco, Rob J.A. van Dijk und H.W. Peter Vijeboom (Hg.): Heideggers These vom Ende der Philosophie, Bonn 1989, S. 33-48 (Verhandlungen des Leidener Heidegger-Symposiums April 1984)