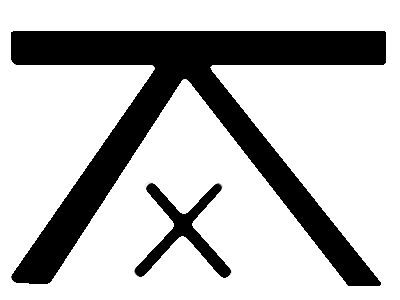Walter Tydecks
Neuere Geschichte der Mathematik in Deutschland
Inhaltsverzeichnis
Rückblick ins 19. Jahrhundert
Grundlagendiskussion und Deutsche Mathematik
Mathematik in der Sowjetunion
Die Nachkriegsentwicklung
Die Zeit der Studentenbewegung
Mathematik im Zeichen der EDV
Die Mathematik gilt als Musterbeispiel für eine reine, "unpolitische" Wissenschaft mit gewissermaßen zeitlosem Charakter. Geschichte der Mathematik: Das umfaßt daher grundsätzlich ein Spannungsverhältnis, und erst recht im 20. Jahrhundert in Deutschland mit seinen tiefen Einschnitten und Brüchen. Nur die 1950er Jahre erscheinen als normale Entwicklungszeit für die Mathematik, doch wird sich zeigen, dass gerade in diese Jahre der größte Einschnitt fällt.
Verwicklungen der Mathematik in den Nationalsozialismus werden verdrängt und höchstens als individuelles Problem einzelner Mathematiker angesehen und als persönliche Anklage nachgewiesen. Die Beteiligung der Studentenschaft auch bei den Mathematikern an der NS-Bewegung wird sozialpsychologisch aus der Jugendbewegung erklärt, alle fachspezifischen Motive werden übergangen. Die NS-Zeit gilt als Fremdkörper in der Mathematikgeschichte.
Auf der anderen Seite konnte auch die 68er-Bewegung nur wenig mit den Naturwissenschaften und insbesondere der Mathematik anfangen. Sie verstand sich als Kulturrevolte im Überbau, vorwiegend in den humanistischen Fächern, und sah ihre wichtigste Aufgabe im Entwurf einer Politisierungs- und Emanzipationsstrategie, in der politischen Bildung der Gesellschaft. Und die galt es nicht nur aus der Uni hinauszutragen, sondern auch den von Haus aus unpolitischen Naturwissenschaftlern war klarzumachen, was sie da eigentlich lernen, wozu ihre Wissenschaft eingesetzt wird. Nur leider lieferten die Orientierungsgrößen der Studentenbewegung (Frankfurter Schule, Lukacs, Psychoanalyse, Marxismus, Leninismus, Maoismus, Marcuse, Guevara) kaum Ansätze für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften und der Mathematik, und so versandeten die Anstöße in dieser Richtung. Die Studentenbewegung blieb ihrerseits aber Orientierungspunkt für einige selbständige Bewegung bei den Naturwissenschaftlern und Mathematikern, deren Auswirkungen bisher aber nur schwer zu ermessen sind.
Der folgende Beitrag soll auch Nichtmathematikern etwas mehr Verständnis für die jüngere Geschichte der Mathematik ermöglichen und die Vorstellung einer reinen, zeitlosen Mathematik erschüttern helfen. Auf neue Entwicklungen im Gebiet der Anschaulichen Geometrie wird in der Symbolischen Mathematik eingegangen.
1. Rückblick ins 19. Jahrhundert
Im 19.Jahrhundert kam es in Forschung, Lehre und Anwendung der Mathematik zu Veränderungen, die zu der heute gültigen modernen Mathematik mit ihrem hohen Grad an Abstraktheit, Formalität und internationalen Standards führten. Inzwischen ist nahezu vergessen, welch große nationalen Besonderheiten es noch bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegeben hatte.
In England war die Forschung traditionell an den Anwendungen in industrieller Produktion und wissenschaftlichen Experimenten orientiert. Newton war das große Vorbild. Auch wenn es Grundlagenforschung gab, wie die Arbeiten von Boole, Cayley und Sylvester in der Algebra, stand die Forschung der meisten Mathematiker in direktem Zusammenhang mit physikalischen Anwendungen. Insbesondere sind Hamilton und Maxwell zu erwähnen, die in Mechanik und Elektrodynamik eine grundsätzliche Umwälzung der mathematischen Methoden vollzogen, die bis heute die mathematische Physik prägen. Daher ist es auch kein Zufall, dass am ehesten in England unter den Mathematikern eine Strömung entstand, die sich auf die Arbeiterbewegung bezog und vor allem zur Erforschung der Mathematikgeschichte wichtige Beiträge lieferte.
Weitaus stärker als in anderen Ländern bewegten sich französische Mathematiker in den Kreisen angesehener Philosophen und der bürgerlichen Gesellschaft, politisches Engagement war für sie eine Selbstverständlichkeit. Das hängt mit ihrer sozialen Herkunft zusammen. Meist gingen sie den Weg über Eliteschulen, die adlige und großbürgerliche Kreise bevorzugten. Der Mathematiker d'Alembert war zugleich ein Hauptvertreter der aufklärerischen Enzyklopädisten. Nach der Revolution von 1789 wurde als Revolutionsschule die ecole de polytechnique gegründet, an der Mathematiker wie Lagrange und Laplace eine führende Rolle spielten. Viele Mathematiker arbeiteten direkt für die militärischen Bedürfnisse Napoleons, einige begleiteten ihn auf seinem Ägypten-Feldzug.
Wie die Aufklärung insgesamt orientierte sich hier die Mathematik stark an klassischen Vorbildern, vor allem der euklidischen Geometrie. Nach ihrem Vorbild sollten die Differential- und Integralrechnung und die neuen physikalischen Gebiete (Mechanik, Elektrostatik) axiomatisch begründet und in vergleichbarer Klarheit, Strenge und Eleganz durchgearbeitet werden. Aufklärung heißt hier auch, dass weniger auf trügerische Sinne und die oft verwickelten Züge der mittelalterlichen Zahlenmystik vertraut wurde, als auf die Schärfe des menschlichen Verstandes. Mathematische Ergebnisse werden öffentlich diskutiert und unterliegen nicht mehr der Geheimniskrämerei wie noch im Barockzeitalter. So entstand in der ecole de polytechnique das Modell der modernen Mathematik, die nach größter Transparenz und innerer Widerspruchsfreiheit strebt und bewußt auf den direkten Bezug auf Anschauung und Anwendung verzichtet. Auch wenn später andere Mathematiker wie Cauchy oder Hermite politisch den Monarchisten nahe standen, hielten sie sich in ihrer mathematischen Arbeit an dieses Vorbild. Es ist bis in die Gegenwart gültig geblieben und hat mit den Arbeiten von Bourbaki und Dieudonne seit den 1950er Jahren die gesamte Mathematik in den entwickelten Ländern dominiert.
Diese Mathematik ist untrennbar verbunden mit der aufklärerischen demokratischen Bildungsreform, die jedem den Zugang zur Universität und Wissenschaft ermöglichen will, der dafür Verstand genug hat. Seit 1789 waren die führenden Mathematiker in Frankreich immer auch führende Hochschullehrer. Der bestmögliche axiomatische Aufbau galt zugleich als der pädagogisch sinnvollste. Die Lehrbücher von Lagrange sind bis heute Standard auf ihren Gebieten. Das jüngste Beispiel für den engen Zusammenhang von Forschung und Lehre war die von Bourbaki geförderte Begründung der Mathematik durch die Mengenlehre, die im Schulunterricht nachvollzogen werden sollte.
Der Weg von England oder Frankreich nach Deutschland scheint zu Beginn des 19. Jahrhunderts direkt ins Mittelalter zu führen, was aber keineswegs bedeutet, dass das Niveau der mathematischen Arbeiten hier niedriger war. Industrielle Anwendung wie in England gab es nicht, und anders als in Frankreich lebten die meisten Mathematiker in kleinen Universitätsstädten wie Göttingen. Sie kamen oft aus Pastorenfamilien. Mathematik stand in engem Zusammenhang zu Philologie und Theologie. Oder sie kamen wie Gauß aus ärmlichen Verhältnissen und fielen durch ihre Mathematikleidenschaft auf, was Gönner aufmerksam machte, vergleichbar der Förderung von ungewöhnlichen Musikern. Oft lebten sie als Lehrer oder angestellt bei Sternwarten. Felix Klein, selbst einflußreicher Mathematiker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat sie in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik im 19. Jahrhundert mit viel Sympathie und persönlichem Verständnis portraitiert. Meist lebten sie zurückgezogen, engagierten sich weder in politischen noch hochschulpolitischen Fragen, hielten sich aus der Lehre lieber zurück. Im Unterschied zu zahlreichen Physikern gab es keine Bezüge zur naturromantischen Bewegung. Ausnahmen waren der Berliner Jacobi (1804-1851), der sich den französischen Mathematikern verbunden fühlte und - wie auch sein Schüler Riemann - an der 1848er Revolution beteiligt war, sowie Dirichlet (1805-1859), der 1822-27 in Paris die neue Mathematik kennenlernte. Dirichlet ging 1855 als Nachfolger von Gauß nach Göttingen, wo damals neben Riemann der mit ihm befreundete Dedekind (1831-1916) wirkte. Ihre Tendenz »Gedanken an die Stelle der Rechnung zu setzen« (Dirichlet 1852) blieb jedoch isoliert und sowohl bei Mathematikern wie Philosophen unverstanden. Darauf soll später unter dem Stichwort Prinzipienphysik bzw. einer neu verstandenen Freien Mathematik zurückgekommen werden.
Anders als bei den Geistes- und Geschichtswissenschaften, der Medizin und auch der Physik gewann die NS-Bewegung bei den Mathematikern nur wenig Einfluß. Von den deutschen Mathematikern entstand das Bild zurückgezogener Eigenbrötler, in deren Denken noch der Geist mittelalterlicher Dunkelheit fortlebte. Gauß ist zweifellos hierfür meistgenannt. Aus Scheu vor Fehlern veröffentlichte er nur einen kleinen Teil seiner Entdeckungen. In all seinen Einführungen grundsätzlich neuer Richtungen wie der imaginären Zahlen oder der nicht-euklidischen Geometrie bemühte er sich immer, nicht die Anschauung zu verlassen, sondern sie nachvollziehbar zu erweitern. Hierfür dienten z.B. umfangreiche kartographische Arbeiten in Niedersachsen.
Im Zuge der Industrialisierung und der Durchsetzung der Aufklärung verschwanden diese Besonderheiten allmählich. Eine Schlüsselrolle spielte die Gründung der Berliner Universität. Der internationale Standard von London oder Paris wurde angestrebt (Jacobi, Weierstraß), aber erst um 1900 verlagerte sich der Schwerpunkt der mathematischen Forschung von Göttingen nach Berlin. Nach französischem Vorbild wurden der Schul- und Hochschulunterricht umgebildet.
2. Grundlagendiskussion und Deutsche Mathematik
Eine Grundlagendiskussion der Mathematik wurde im wesentlichen nur in Deutschland und Holland geführt, auch wenn wichtige Beiträge aus England (Russell, Whitehead, Church und Turing, alle im Umkreis von Wittgenstein) und Skandinavien (Skolem) kommen. In Frankreich und England verlief der Weg der Mathematik in die Modernisierungsepoche des 20. Jahrhunderts geradlinig. Ganz anders in Deutschland. Hier wurde in der Tradition der Romantik und Nietzsches Philosophie frühzeitig umfassende Kritik an der Modernisierung geleistet, sei es in den frühen Schriften von Bloch und Lukacs, bei Heidegger oder von der Frankfurter Schule. Bei allen taucht der Gedanke auf, die moderne Zivilisation wird unmenschlich, wenn nach und nach alle Wissenschaft und Technik mathematisiert wird. Mathematisierung heißt hier, dass die Wissenschaften nach dem Vorbild der euklidischen Geometrie und klassischen Mechanik axiomatisiert und auf mathematische Gesetze reduziert werden, kann also als Übernahme des französischen Weges der Mathematik verstanden werden. Nur war diese Umgestaltung auch bei den deutschen Mathematikern keineswegs unumstritten und bildete den Gegenstand der Grundlagendiskussion.
Die Formalisten vertraten das Programm möglichst weitgehender Axiomatisierung. Ausgehend von der Berliner Universität (und hier namentlich Jacobi, Weierstraß, Hilbert) wurde die Grundlegung in einer axiomatischen Metamathematik gesucht, mit deren Hilfe alle Sätze der Mathematik widerspruchsfrei und vollständig zu beweisen sind und jede mögliche mathematische Aussage auf ihre Richtigkeit überprüft werden kann. Philosophisch wurde dies Programm in Wien zum Logischen Rationalismus und zum Vorbild für alle mögliche Wissenschaft erhoben. Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit und Entscheidbarkeit sind die Programmpunkte aufgeklärter Wissenschaft, die sich demonstrativ gegen Metaphysik, Idealismus, Intuition und sinnliche Anschauung wendet.
Obwohl die euklidische Geometrie das große Vorbild ist, ging sie doch von Axiomen aus, deren Berechtigung gerade in ihrer unmittelbar anschaulichen Bedeutung gesehen wurde. Z.B. das Axiom, dass das Teil kleiner als das Ganze ist. Nur das Axiom, dass sich parallele Geraden nie schneiden, verließ die Anschauung, da unendlich verlängerte Geraden nicht sinnlich wahrnehmbar sind. Seit der euklidischen Geometrie ist der Unendlichkeitsbegriff der Knotenpunkt für alle Axiomensysteme.
In der neueren Mathematik stellt sich diese Frage ausgehend von Ableitung und Integral anders. Es wird gefragt, wie viele Punkte ein Kontinuum hat, oder mathematischer gesprochen, wie viele reelle Zahlen es gibt. Während jede endliche Menge gemessen werden kann, indem sie abgezählt wird, und ebenfalls jede Teilmenge der natürlichen, ganzen oder gebrochenen Zahlen, gibt es für kein Intervall der reellen Zahlen eine Möglichkeit zum Abzählen, sie sind überabzählbar. Die Anschauung ließ sich aber von dem Meßverfahren durch Zählen leiten und versagt bei reellen Zahlen. In dieser Situation gibt es zwei Wege: Die Formalisten sagen, unabhängig von möglicher Anschauung genügt es, das Rechnen mit reellen Zahlen formal durch Axiome widerspruchsfrei abzusichern. Die Intuitionisten setzen dagegen, dass die Mathematik ihre Verankerung im menschlichen Denkvermögen und im natürlichen Gegenstand verliert, wenn sie prinzipiell die Anschauung aufgibt (so auch die Argumentation von Heidegger in Die Technik und die Kehre gegen die mathematisierten Naturwissenschaften). Statt dem formalen Begriff reeller Zahlen und den formalen Operationsregeln zuzustimmen, wollen sie daher nur endliche, ausführbare, konstruktive Beweisverfahren zulassen, die reelle Zahlen nur annähern können, das allerdings beliebig genau. Die Mathematik mit überabzählbaren Mengen lehnen sie ab. Entsprechend der allgemeinen Zivilisations- und Kulturkritik wird hier gegen den Formalismus eingewandt, dass er menschliches und natürliches Maß übersteigt. Das Maß kann im Fall der Mathematik konkret durch den Begriff der überabzählbaren Menge definiert werden, überabzählbare Mengen sind für die menschliche Anschauung maßlos.
Der Ausgang der Grundlagenkrise ist bis heute offen. 1936 hat Gentzen in der nationalsozialistischen Zeitschrift Deutsche Mathematik den Stand der Grundlagenforschung dargestellt, wie er seitdem so gut wie eingefroren ist. Auf den ersten Blick ist durch die Arbeiten von Church, Gödel und Skolem der formalistische Standpunkt völlig unhaltbar worden: Church wies nach, dass nicht einmal für die formale Prädikatenlogik, geschweige denn für die ganze Mathematik, ein allgemeines Entscheidungsverfahren gefunden werden kann, das für alle Aussagen in diesem Gebiet die Frage nach richtig oder falsch klären kann. Gödel zeigte, dass nicht einmal die Zahlentheorie vollständig axiomatisiert werden kann.
»Man kann es auch so ausdrücken, dass sich für die Zahlentheorie kein ein für allemal ausreichendes System von Schlußweisen angeben lässt, sondern dass vielmehr immer wieder Sätze gefunden werden können, deren Beweise neuartige Schlußweisen erfordern.« (Gentzen, in: Deutsche Mathematik 1938, S. 260)
Damit hängt direkt der Nachweis zusammen, dass nicht einmal in der reinen Zahlentheorie die innere Widerspruchsfreiheit bewiesen werden kann. Die Ideale der Formalisten bleiben daher bloße Programmpunkte, Orientierungen für die Mathematiker, ohne je eingelöst werden zu können (regulative Ideen, würde Kant sagen). Das gilt aber genauso für die Intuitionisten, die ebenfalls keine vollständige Grundlegung der Mathematik leisten können. Ein Resultat der Grundlagendiskussion ist damit auf jeden Fall, dass die Mathematik entgegen allen Vorurteilen ein offenes System ist.
Wenn es aber für die Mathematik keine klar umrissenen Grenzen gibt, sprach das praktisch zunächst für die Formalisten. Denn nun gilt es nur noch, in dem offenen Gebiet der Mathematik mit Methoden zu arbeiten, die wenigstens in sich widerspruchsfrei sind. Wenn die Mathematik ein offenes System ist, kann sie nicht auf die Eigenschaften der menschlichen Anschauung eingeengt werden. Hier ist zu erinnern, dass Anschauung in der Mathematik in der Regel in Anlehnung an Kant gleichgesetzt wurde mit Zählen und geometrischen Konstruktionen. Mathematik galt als anschaulich, wenn ihre Formeln letztendlich auf Operationen mit endlichen Zahlen oder auf geometrische Demonstration zurückgeführt werden können.
Während Church und Gödel Sätze gegen die Formalisten beweisen wollten, trat Skolem als Formalist auf, er bewies einen Satz über überabzählbare Mengen. Nur greift sein Satz weit stärker die Grundposition der Formalisten an. Er besagt in der Darstellung durch Gentzen: »Wenn zu einem Axiomensystem von ,bestimmter Art' überhaupt ein Modell, beliebig hoher Mächtigkeit, existiert, so existiert auch bereits ein abzählbares Modell, welches das Axiomensystem erfüllt.« (Gentzen, ebd., S.251) Wie auch immer die Formalisten die Mathematik mit den reellen Zahlen axiomatisieren wollen, diese Axiome werden auch durch eine abzählbare, von den Intuitionisten zugelassene Menge erfüllt. Und mit den Axiomen natürlich auch alle Sätze, Definitionen und Beweise, die darauf aufbauen. Konsequent folgert Gentzen, dass es den Formalisten unmöglich ist, Axiome oder Sätze aufzustellen, die wirklich den überabzählbaren Mengen gerecht werden, also nicht auch für abzählbare Mengen gelten. Außer der puren Eigenschaft der Überabzählbarkeit sind keine weiteren spezifischen Eigenschaften dieser Mengen mit den Methoden der Formalisten erkennbar. Was ist dann gegen die Intuitionisten zu sagen, die ganz darauf verzichten wollen?
Der Ausweg kann nur darin gesehen werden, die qualitativen Eigenschaften der Anschauung zu erweitern und das Modell der zahlentheoretischen, formal logischen Axiome zu verlassen, die Mathematik also nicht auf der formalen Logik aufzubauen. Das hatte viel früher schon Hegel erkannt, und der Ausweg kann daher in einer ersten Annäherung als dialektische Rekonstruktion der Mathematik benannt werden.
Historisch ging es aber anders weiter. Dass Gentzen in der Deutschen Mathematik veröffentlichte, ist keineswegs ein Zufall. Die Grundlagendiskussion entstand in Deutschland und wurde hier im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Bewegung und Machtergreifung zur Deutschen Mathematik. Deren Wortführer war Ludwig Bieberbach, sicherlich einer der einflußreichsten deutschen Mathematiker im 20. Jahrhundert, auch wenn er wegen seines Engagements für die Deutsche Mathematik gern totgeschwiegen wird. In der mathematischen Arbeit wollte er wie seine Kollegen an Gauß anknüpfen. Die Stärken von Gauß lagen in Zahlentheorie, Funktionen mit komplexen Zahlen und der Differentialgeometrie. Die Differentialgeometrie wurde von Gauß und seinem Nachfolger Riemann als nicht-euklidische Geometrie begründet. In der euklidischen Geometrie ist die Konstruktionsfläche eben, die in ihr verlaufenen Geraden daher bis in die Unendlichkeit geradlinig. Das ist aber von der Anschauung her nicht zwingend, und so ergibt sich hier durchaus der Anschauung folgend die Möglichkeit der Erweiterung. Die nicht-euklidische Geometrie ist gekrümmt, die Konstruktionsfläche etwa die Oberfläche auf einer Kugel. Wie eine gekrümmte Kurve durch eine Tangente angenähert werden kann, soll die gekrümmte Fläche durch die Tangentialfläche, allgemeiner der gekrümmte Raum durch den Tangentialraum angenähert werden, daher der Name Differentialgeometrie. Gauß drang damit bewußt in Bereiche vor, die die alte Anschauung verließen, aber es war ihm wichtig, auch für die neuen Schritte angemessene Anschauungen zu finden, z.B. die Kartographie auf der unebenen Oberfläche. Mit Einstein wurde später allgemeiner die Gravitationstheorie Grundlage für die Anschauung.
Bieberbach war führender Vertreter der Differentialgeometrie, philosophisch hing er zunächst dem Neo-Kantianismus an und stand dem Intuitionismus nahe. 1934 hielt er vor der Preußischen Akademie der Wissenschaft eine programmatische Rede Stilarten mathematischen Schaffens. Als Differentialgeometer lag ihm die Raumanschauung nahe, und in schwindelerregender Weise überhöhte er dies in eine rassistische Theorie. Er beruft sich auf Felix Klein,
»dass die wohlentwickelte Raumanschauung ein vorherrschendes Merkmal der deutschen Rassen ist, während der rein logische Sinn bei den romanischen und hebräischen Rassen reicher entwickelt ist. (...) Die rassische Zugehörigkeit äußert sich auf geistigem Gebiete im Stile des Schaffens und in der Wertung der Ergebnisse und, wie ich glaube, in der Einstellung zu den Grundlagenfragen. (...) Der Formalismus, der unabhängig von menschlicher Eigenart ein absolutes Reich mathematischer Wahrheiten errichten will, der Intuitionismus, der davon ausgeht, dass das mathematische Denken eine menschliche Verrichtung ist und vom Menschen und seiner Eigenart somit nicht losgelöst werden kann.« (Bieberbach, Stilarten mathematischen Schaffens, S. 357)
Ihm ist auch kein Gegenargument, dass Hilbert, der Wortführer der Formalisten, Ostpreuße war. Noch verrückter wird es, wenn in der Deutschen Mathematik Einstein wütend attackiert wird, weil er als Jude eine unanschauliche Relativitätstheorie entwickelt habe. Diesen Ruf hat er bis heute, obwohl gerade er wie Gauß eine wahre Flut an Anschauungsmaterial geliefert hat. Ganz im Gegensatz zu der von Heisenberg und der Kopenhagener Schule entwickelten Quantenmechanik, die bewußt die Anschauung verlässt, hat Einstein für die qualitative Erweiterung der Anschauung die größten Fortschritte erzielt.
Bieberbach blieb jedoch unter seinen Kollegen isoliert. Die Deutsche Mathematik war im wesentlichen eine Studentenbewegung, die Fachschaften waren von Nationalsozialisten dominiert. In der ersten Nummer der Deutschen Mathematik veröffentlicht der Reichsfachabteilungsleiter Mathematik der Deutschen Studentenschaft, Kubach, gewissermaßen als Editorial den Artikel Studenten, in Front!. Die Studenten sollen gegen die Mehrheit der Professoren mobilisiert werden, die sich der nationalsozialistischen Bewegung nicht anschließen wollen. Inhaltlich beruft er sich auf die Rede von Bieberbach und wirft den liberalen Professoren vor, dass für sie »die Mathematik als Prototyp der reinen, voraussetzungslosen und internationalen Wissenschaft« gilt (Kubach, in Deutsche Mathematik 1936, S. 5). Dagegen Kubach:
»Grundsätzlich haben wir jenen die Keime der Zerstörung und Zersetzung in sich tragenden Argumenten immer zunächst das eine entgegenzusetzen: unsere nationalsozialistische Weltanschauung mit ihrem Anspruch auf die totale Erfassung unseres gesamten Schaffens und Wirkens, ausnahmslos auf allen Gebieten. Unser fanatischer Glaube an die Richtigkeit dieser unser Anschauung.« (ebd.) Gegen die »Reden und Aufsätze alter Oberlehrertypen über die Mathematik als die einzige Wissenschaft, die zu Zucht, Ordnung, klaren Denken usw. erziehe« (Kubach, ebd., S. 8), sollen Arbeitsgemeinschaften und Lager gebildet werden, in denen »in kameradschaftlicher Geschlossenheit« die Mathematikgeschichte studiert und die Weltanschauung der Mathematiker revolutioniert werden sollen.
1936 kommt in der Deutschen Mathematik auch Bieberbach auf Fragen des mathematischen Universitätsunterrichts. Er will den Unterricht »persönlicher« gestalten und »die künftigen Lehrer so erziehen, dass sie einen lebensnahen Unterricht erteilen können« (S. 14). Dies Anliegen wird später auch von der Studentenbewegung der 1970er Jahre wiederholt und ist inzwischen Bestandteil der schulpolitischen Programmatik jeder politischen Partei. In den 1930er Jahren sind die Grundlagendiskussion und die Diskussion der Bildungsreform untrennbar verbunden. Die Formalisten sind Teil der aufklärerischen Bewegung, die Hochschule und Wissenschaft jedem öffnen will, der Geist genug hat, die Wissenschaft zu verstehen. Die Studenten sollen sich gerade in der Mathematik durch die trockenen, axiomatischen Anfängervorlesungen durchbeißen, die Schwierigkeit und Unanschaulichkeit des Stoffs leistet die gewünschte Auslese. Bis heute brechen etwa die Hälfte aller Mathematikstudenten das Fach in den ersten Semestern ab.
Die nationalsozialistische Deutsche Mathematik zeigt auf einen Schlag die enge Verknüpfung der methodischen Grundlagendiskussion und der Bildungsreform. Anders als zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Frankreich wirkt sie in Deutschland nicht als Befreiung, sondern als bürokratische Erstarrung. Das Verhältnis zwischen Lehrkörper und Studentenschaft verhärtet sich (unverständliche Vorlesungen, Willkür und Serienabfertigung in den Prüfungen), wie auch der Umgangston der konkurrierenden Gelehrten untereinander an den größer werdenden Hochschulen rauher wird, wo unter den Professoren Hierarchien des Ansehens und der Beliebtheit entstehen. Unter der Oberfläche der humanistischen Bildungsuniversität werden härteste Gefechte ausgetragen, die bis dahin führen, dass die revoltierenden Studenten für den Streit der Lehrmeinungen eingesetzt werden sollen. Nur in diesem Klima sind die Verstiegenheiten der Deutschen Mathematik zu erklären, wie auch die Verunsicherung der Studentenschaft, die zum leidenschaftlichen, maßlosen Engagement tendiert.
3. Mathematik in der Sowjetunion
Während in Deutschland Aufklärung und Bürokratie nur schwer zu trennen waren, kam es gleichzeitig im weit rückständigeren Rußland zu einem tiefen Umbruch. Ausgelöst durch die Oktoberrevolution wurde er von ähnlichem Enthusiasmus getragen wie gut 100 Jahre früher in Frankreich. Im Land herrschte ein wahrer Bildungshunger und ein Ansturm auf alle Bildungsmöglichkeiten. Gerade in den Ingenieur- und Naturwissenschaften gab es eine ungeheure Aufbruchstimmung, die in den experimentellen Kunstbewegungen (Majakowski, Eisenstein, Konstruktivismus etc) ihr Gegenstück fand. Das hat alle westlichen Besucher begeistert und wird auch von Dissidenten wie Solschenizyn bestätigt. Wer in Deutschland trotz der widrigen Umstände an den befreienden Wirkungen der Aufklärung festhalten wollte, verfolgte naturgemäß interessiert die Entwicklung in der Sowjetunion.
Und umgekehrt begann die sowjetische Grundlagenforschung angeregt durch Lenin mit dem Studium der naturphilosophischen Schriften von Hegel, Marx und Engels. Von Engels wurde erstmals die Dialektik der Natur editiert, von Marx die Grundrisse mit ihren zahlreichen Ausführungen zur technologischen Entwicklung und die Mathematischen Manuskripte. In der Zeitschrift Unter dem Banner des Marxismus stand zwar die Diskussion physikalischer Grundlagenfragen (Relativitätstheorie, Quantentheorie) im Vordergrund, aber in den 1930er Jahre finden sich auch zwei Aufsätze zur Mathematik. Kolman und Janowskaja diskutieren Hegels Philosophie der Mathematik, Glivenko vergleicht die Mathematischen Manuskripte von Marx mit thematisch ähnlichen Ansätzen des französischen Mathematikers Hadamard. Bis heute haben diese Aufsätze einen einmaligen Stellenwert, da in den 1950er Jahren diese Diskussion in der Sowjetunion versandete und in den westlichen Ländern nicht weiter zur Kenntnis genommen wurde. Und doch sind sie etwas eigenartig.
Hegel konzentrierte sich auf den mathematischen Unendlichkeitsbegriff, an dem sich auch die Grundlagendiskussion entzündete. Wie später Marx studierte er die neue Mathematik ausschließlich aus französischen und englischen Lehrbüchern, im wesentlichen von Lagrange. So wie die deutschen Mathematiker keine Verbindung zur Romantik oder Aufklärung hatten, wurden sie umgekehrt von den deutschen Philosophen übersehen. Das hatte die Folge, dass Hegel sozusagen rein philosophisch postulierte, dass die neue Mathematik nicht auf der formalen Logik begründet werden kann, aber den Ausweg nur in einer philosophischen Begründung von außen mithilfe der dialektischen Methode sah. Trotz aller anderslautenden Beteuerungen sind ihm hierin Engels und die sowjetische Diskussion gefolgt. Kolman und Janowskaja leiten zwar aus Hegels Schriften die Notwendigkeit einer dialektischen Rekonstruktion der Mathematik ab und wollen sie nicht von außen philosophisch führen. Aber sachlich gelingen ihnen hierfür weder Beiträge noch Ansätze.
Sie betrachteten die mathematische Grundlagendiskussion vor allem unter dem Aspekt, auch in der Mathematik den Klassenkampf zu führen. Wie Hegel sehen sie nicht die besondere Entwicklung der Mathematik in Deutschland und erkennen nicht, wie dort im Grunde das geleistet wurde, was Hegel postulierte: Der mathematische Beweis für die Unmöglichkeit, die höhere Mathematik (die Mathematik der reellen Zahlen) auf der formalen Logik zu begründen. Damit gehen sie genau an den mathematischen Arbeiten vorbei, wo ihr Programm einer dialektischen Rekonstruktion hätte ansetzen können.
Stattdessen sind sie wie alle philosophischen Beiträge in der Sowjetunion dem starken Duck durch die innerparteilichen Linienkämpfe ausgesetzt und enden in einem Bekenntnis für den aktuellen Fünf-Jahres-Pan statt in einem klaren Forschungsprogramm. Hier ist schon angelegt, warum diese Ansätze nicht fortgeführt wurden und auch im Ausland keinen Widerhall fanden. Wo in den 1970er Jahren in der Studentenbewegung vereinzelt versucht wurde, den Weg in dieser Sackgasse neu aufzunehmen, war das ebenfalls zum Scheitern verurteilt.
Der Schwung der frühen sowjetischen Entwicklung äußerte sich aber durchaus in der mathematischen Forschung und Lehre und ist bis heute zu spüren. Ohne direkte Verbindung zur philosophischen Diskussion wurden gerade in den anwendungsbezogenen Gebieten der Mathematik (Lösung von Differentialgleichungen, Wahrscheinlichkeitstheorie) neue Wege eingeschlagen und an qualitativ neuen, eher geometrischen Methoden gearbeitet. So entstand das paradoxe Ergebnis, dass die sowjetische mathematische Forschung zu einem guten Teil das leistete, was in der deutschen Diskussion verlangt wurde: Eine Belebung der geometrischen Anschauung in den Kerngebieten der höheren Mathematik. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass dann in den Nachkriegsjahren die sowjetische Forschung notwendig stärker auf die Differentialgeometrie gebracht wurde und insbesondere mit den Arbeiten von Arnold dort eine führende Position einnimmt, wo Bieberbach begonnen und die Deutsche Mathematik angesiedelt hatte.
Es war auch nur konsequent, dass anders als in den westeuropäischen Ländern in der Sowjetunion nicht die französischen Lehrbücher übernommen wurden, sondern eigene entstanden. Sie sind klar aufgebaut, aber nicht so axiomatisch trocken, und sie teilen vor allem nicht die arrogante Unsitte, Beweisschritte nur anzudeuten und den Leser zu zwingen, mühsam die fehlenden Zwischenschritte zu enträtseln. Dafür sind sie voll mit physikalischen Beispielen und Anschauungsmaterial. Vor allem sind hier die Lehrbücher von Smirnow und Fichtenholz zu nennen, die dann auch in Deutschland wachsende Beliebtheit genossen. Für die neueren Lehrbücher von Arnold gilt das aber nur noch eingeschränkt. Zwar wird die geometrische Anschauung viel stärker und bewußter entwickelt, aber in der Knappheit der Beweisschritte stehen sie den französischen Büchern in nichts mehr nach.
4. Die Nachkriegsentwicklung
Nach dem 2. Weltkrieg erstarb in Deutschland aufgrund der Verkrustung des Stalinismus und mit Beginn des Kalten Krieges das Interesse an der sowjetischen Entwicklung. Aber auch die intuitionistische Richtung hatte wegen ihrer Verwicklung mit der Deutschen Mathematik ihr Ansehen verloren. Alle deutschen Sonderwege wurden eingeebnet, und die 1950er Jahre sind geprägt durch den überwältigenden Erfolg des Monumentalwerks Elemente der Mathematik der französischen Mathematikergruppe Bourbaki. Zweifellos ist es zu großen Teilen in seiner Konsequenz faszinierend, und auch in vielen Gebieten hervorragend als Lehrbuch zu benutzen (insbesondere in den später erschienenen Bänden über Neuentwicklungen der Mathematik, wie Lie-Algebra). Sein Einfluß hat aber auch eine tiefe philosophische Dimension, die gerade darüber wirkte, dass sie unter dem Mantel völliger Ablehnung von Philosophie auftrat. Obwohl ein Ergebnis der Grundlagendiskussion war, dass die axiomatische Begründung der gesamten Mathematik unmöglich ist, wollten sie in bewußter Anlehnung an die Elemente der Geometrie von Euklid den historisch einmal erreichten Wissensstand umfassend axiomatisch darstellen.
Die strenge formalistische Position wurde verbal aufgegeben, und sie machten gewisse Zugeständnisse an den Intuitionismus. 1951 schrieben sie in einem programmatischen Artikel Die Architektur der Mathematik:
»Wir müssen vielmehr immer wieder die fundamentale Rolle hervorheben, die im Forschen des Mathematikers jene eigentümliche, von gewöhnlichen Sinnesanschauungen ganz verschiedene Art von Intuition spielt, die aller eigentlichen Verstandestätigkeit vorausgeht und die in dem richtigen Erspüren des normalen Verhaltens besteht, das er von seinem mathematischen Wesen glaubt erwarten zu dürfen.« (Bourbaki, in: Otte Mathematiker über Mathematik, S. 151)
Als Beispiel nennen sie die Einführung der komplexen Zahlen durch Gauß. Nur hat Gauß ganz im Gegenteil nach einer sinnlichen, »gewöhnlichen« Anschauung gesucht, gerade für die komplexen Zahlen, die er auf einer ebenen Fläche veranschaulichte. Aus der Anschauung wird für Bourbaki ein unfaßbares »Gespür«.
In den Nachkriegsjahren wurde in Deutschland endgültig das moderne Bildungswesen errichtet, in dem alle Professoren große Vorlesungen halten und ihre Forschungsergebnisse bestenfalls in Seminaren vortragen. Gab es im 19. Jahrhundert kaum Lehrbücher von deutschen Mathematikern, erschienen nun eine Reihe von nachgedruckten Vorlesungen, die praktisch alle an der axiomatischen Methode von Bourbaki ausgerichtet sind und darum wetteifern, wer am abstraktesten die Mathematik einführen kann, bis sie allesamt in dieser Hinsicht durch die Grundzüge der modernen Analysis von Dieudonne übertroffen wurden, einem Mitarbeiter von Bourbaki. Allerdings gibt es auch Ausnahmen wie das im Göschen-Verlag erschienene Bändchen über Funktionentheorie von Knopp, in dem noch viel zu spüren ist von der älteren, anschaulicheren Herangehensweise.
Durch den axiomatischen Lehrstil entstand ein tiefer Bruch in der Mathematikgeschichte, was besonders die deutsche Tradition betraf. Die Erkenntnisse und Werke der früheren Mathematiker tauchen nur noch zur Bezeichnung der von ihnen zuerst bewiesenen Sätze auf (Satz von Gauß, von Cauchy, etc.). Ihre Originalwerke werden nicht mehr gelesen, sie werden nicht übersetzt (aus den Fremdsprachen bzw. die älteren Autoren aus dem Lateinischen). Eine einzige Ausnahme ist die Arbeit Grundlagen der Mathematik von Oskar Becker mit zahlreichen Originaltexten. Mathematikgeschichte reduziert sich entweder auf einen Vergleich der Beweistechniken in moderner Darstellung oder in Legendenbildung über geniale große Mathematiker (allen voran natürlich immer wieder Gauß). Aus heutiger Sicht ist kaum mehr vorstellbar, dass bis in die 1930er Jahre das Werk der einzelnen Mathematiker ähnlich gewürdigt wurde wie die Werke einzelner Philosophen in der Philosophiegeschichte. Der historische Bruch in der Mathematik lässt sich vielleicht am besten vergleichen mit der Neuen Musik in den 1950er Jahren, die ebenfalls ganz auf absoluten Konstruktionsmethoden beruht und für die Hörgewohnheit jede Beziehung zur vorangegangenen Musik bewußt auslöscht. Nur dass in der Musik die älteren Werke weiter alle Aufführungen in den Konzertsälen dominieren, während in der Mathematik die Werke der älteren Mathematiker in Vergessenheit gerieten und bestenfalls in Sekundärdarstellungen auftauchen.
Die Grundlagendiskussion klang aus in einer Vielzahl von Darstellungen, die die Krise einengen auf einen rein mathematischen Konflikt im Sonderbereich der Metamathematik und Beweistheorie. Jede Verbindung zur Zivilisationskritik ist weg, auch nur ein entfernter Gedanke oder Verweis auf den weltanschaulichen Anspruch der Deutschen Mathematik sind regelrecht tabu. Mathematik gilt als Beweis, dass Wissenschaft am besten ohne Weltanschauung fährt. Die intuitionistische Position wandelte sich in den Konstruktivismus. Sie verlor dort ebenso die Verwurzelung in der Anschauung wie die formalistische Mathematik (siehe etwa die Formale Logik von Lorenzen, in der die intuitionistische Position nur noch versteinert in der axiomatischen Konstruktion des Brouwer-Kalkül oder Gentzen-Kalkül fortlebt).
In der Forschung führte die Dominanz von Bourbaki in eine ungeheure Verästelung und Verzweigung, wo nahezu unübersehbar auf allen Gebieten Spezialuntersuchungen entstanden. Inzwischen werden jährlich in mathematischen Zeitschriften die Beweise für 200.000 neue Sätze veröffentlicht. Sie haben im wesentlichen die Gestalt, dass komplizierte mathematische Kalküle definiert werden, in denen besondere Axiome gelten, die sonst nirgends in der Mathematik vorkommen. Die Mathematik zerfällt in die sogenannten Mutterstrukturen (Stoff der Anfängervorlesungen), die von Bourbaki abschließend dargestellt wurden und wo es nichts Neues mehr zu beweisen gibt, und in die Vielzahl der angelagerten Spezialräume und -gebiete. Diese verlassen immer weiter die Anschauung, stellen sich dar als rein algebraische Verknüpfungen in ungewöhnlichen, unanschaulichen mathematischen Zeichensystemen, und es bedarf jahrelanger Einarbeitung, um wenigstens in eines dieser Gebiete Einblick zu erhalten und etwa eine Seminar- oder Diplomarbeit zu schreiben. Obwohl insgesamt die mathematische Forschung stark ausgedehnt wurde, gibt es für jedes der Spezialgebiete nur kleine, internationale Expertengemeinden, die an ihrem jeweiligen Gebiet weiterarbeiten und sich auf Fachkongressen treffen. Ein Überblick wird von außen durch klassifizierende Dokumentationssysteme geschaffen (in Westdeutschland durch das Fachinformationszentrum Mathematik).
Von dieser Wissensexplosion hebt sich die kontinuierliche, erfolgreiche Weiterentwicklung der Differentialgeometrie ab. In den USA wirkte einflußreich der chinesische Mathematiker Chern, der bei Bieberbach gelernt hatte. In seinem Umkreis gelang es Anfang der 1950er Jahre Yang und Mills, einen ersten Teilbereich der Quantenphysik differentialgeometrisch darzustellen. Sie schlossen an die Tradition von Einstein und Weyl an und brachten die von Einstein gesuchte Umwälzung der Methoden in der Quantentheorie. Alle grundlegenden Erfolge in der weiteren Entwicklung liegen auf dieser Linie. Das Anschauungsmaterial für die Mathematik wurde erheblich erweitert, zur Gravitationstheorie kommen die neuen Feldtheorien.
Obwohl auch einige der angesehensten deutschen Mathematiker auf diesem Gebiet arbeiten (Hirzebruch, Brieskorn), blieb die Differentialgeometrie gegenüber den von Bourbaki kanonisierten Grundlagen im Hintergrund und gelangt erst in den letzten Jahren allmählich in den Bereich der verbindlich zu lernenden Vorlesungen im Grundstudium. Vollständiger konnte der Bruch in der deutschen Tradition nicht ausfallen.
Erstmals erschien 1975 in der westdeutschen Zeitschrift Philosophia naturalis ein Artikel, der die neuere Entwicklung der Differentialgeometrie würdigt: Mathematik als Sprache der Physik von den polnischen Autoren Maurin und Michalski. Sie sehen die Aufgabe der Mathematik darin, vertraute natürliche Strukturen bloßzulegen, mit denen die Physiker aufgrund ihrer empirischen Anschauung arbeiten. Was dem Physiker als selbstverständliche, vorwissenschaftliche Annahme über die Eigenschaften von Raum und Zeit galt, wird jetzt mathematisch beschrieben und in seiner besonderen Qualität erfaßt. Allgemeiner gesprochen soll die Mathematik fixieren, was in der Anschauung das Anschauliche ist, statt sich in die Unanschaulichkeit zu flüchten.
Dieser eine Beitrag blieb aber isoliert und zeigte nur ein einziges Mal, welche Fragen sich in Wahrheit der Mathematik stellen. Sie wurden jedoch in den 1950er und frühen 1960er Jahren innerhalb der Mathematik ad acta gelegt und mußten von außen durch Roman-Schriftsteller und science fiction Autoren neu gestellt werden. Die Mathematik wurde zum Vorläufer einer Entwicklung der Entpersönlichung, des Verlustes von Charaktereigenschaften. Robert Musil hat das früh gespürt, und nicht ohne Grund ist sein Mann ohne Eigenschaften Mathematiker. Er war erst von Napoleon begeistert, wollte dann Ingenieur werden und sah schließlich in der Mathematik die Möglichkeit, eine zufriedenstellende Lebensform zu finden.
»Und so hatte es auch schon damals, als Ulrich Mathematiker wurde, Leute gegeben, die den Zusammenbruch der europäischen Kultur voraussagten, weil kein Glaube, keine Liebe, keine Einfalt, keine Güte mehr im Menschen wohne, und bezeichnenderweise sind sie alle in ihrer Jugend- und Schulzeit schlechte Mathematiker gewesen. Damit war später für sie bewiesen, dass die Mathematik, Mutter der exakten Naturwissenschaften, Großmutter der Technik, auch Erzmutter jenes Geistes ist, aus dem schließlich Giftgase und Kampfflieger aufgestiegen sind. ... Von Ulrich dagegen konnte man mit Sicherheit das eine sagen, dass er die Mathematik liebte, wegen der Menschen, die sie nicht ausstehen konnten. Er war weniger wissenschaftlich als menschlich verliebt in die Wissenschaft. Er sah, dass sie in allen Fragen, wo sie sich für zuständig hält, anders denkt als gewöhnliche Menschen. Wenn man statt Hypothese Versuch und statt Wahrheit Tat und statt wissenschaftlicher Anschauungen Lebensanschauung setzen würde, so gäbe es kein Lebenswerk eines ansehnlichen Naturforschers oder Mathematikers, das an Mut und Umsturzkraft nicht die größten Taten der Geschichte weit übertreffen würde.« (Musil, Mann ohne Eigenschaften, S. 41)
Dennoch gibt Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, die mathematische Forschung auf. Stattdessen stellt er sich die Aufgabe, entsprechend der Mathematik so etwas wie eine mathematische Lebensform zu finden. Allerdings nennt er - oder Musil - das nicht mathematische Lebensform, sondern Utopie der Exaktheit.
»Es hieße also ungefähr soviel wie schweigen, wo man nichts zu sagen hat; nur das Nötige tun, wo man nichts Besonderes zu bestellen hat; und was das Wichtigste ist, gefühllos bleiben, wo man nicht das unbeschreibliche Gefühl hat, die Arme auszubreiten und von einer Welle der Schöpfung gehoben zu werden!« (Musil, ebd., S. 252f)
Schon in den 1920er Jahren geschrieben, trifft dieser Roman genau den Verwicklungsknoten der Mathematik in den 1950er Jahren. Er liegt quer zur vorherrschenden Zivilisationskritik, ohne sie in Gänze abzulehnen, und erst recht zur positivistischen Grundstimmung in der Mathematik. An der Verbindung von Weltanschauung und Mathematik wird festgehalten. Aber es ist nicht nur eine mathematische Utopie, sondern auch eine Utopie der Mathematik. Sie wurde genau in dem Moment geschrieben, als sich die Mathematik vielleicht zu einer Lebensform in diesem Sinn hätte entwickeln können. Musil hat in einem letzten Moment festgehalten, was an der Mathematik begeistern kann außer Vertiefung in Formeln und erfolgreiche Beweise.
Fast wörtlich stimmt seine Utopie der Exaktheit mit der frühen Position Wittgensteins überein, ein ebenso leidenschaftlicher Anhänger der Mathematik. In England stand er in engstem Zusammenhang mit den mathematischen Grundlagenforschungen und hat sie in all seinen Werken einzuschätzen versucht. Ähnlich wie die Mathematiker hat er erkannt, dass die Grundlagenkrise an eine Grenze kam, wo es nicht weiterging. Aber während Bourbaki und mit ihnen die meisten Mathematiker der 1950er und 1960er Jahre daraus folgerten, dann eben den hohen Anspruch der Grundlagendiskussion aufzugeben, will Wittgenstein sich damit nicht zufrieden geben und sieht hier die Aufgabe für die Philosophie.
»Es ist nicht Sache der Philosophie, den Widerspruch durch eine mathematische, logisch-mathematische Entdeckung zu lösen. Sondern den Zustand der Mathematik, der uns beunruhigt, den Zustand vor der Lösung des Widerspruchs, übersehbar zu machen. (Und damit geht man nicht etwa einer Schwierigkeit aus dem Wege). Die fundamentale Tatsache ist hier: dass wir Regeln, eine Technik, für ein Spiel festlegen, und dass es dann, wenn wir den Regeln folgen, nicht so geht, wie wir angenommen hatten. Dass wir uns also gleichsam in unsern eigenen Regeln verfangen. Dieses Verfangen in unsern Regeln ist, was wir verstehen, d.h. übersehen wollen.« (Wittgenstein, Werke Bd. 1, S. 303)
In der Grundlagendiskussion hat sich die Mathematik festgeritten. Wittgensteins Konsequenz war in den Philosophischen Untersuchungen, dass das von ihm selbst früher favorisierte Modell einer axiomatischen Begründung aufgegeben werden muß und sogar die Mathematik als die strengste, logischste Wissenschaft als Sprachspiel zu formulieren ist. Nur das wird der Erkenntnis gerecht, dass die Mathematik ein offenes System ist.
So klafften in den 1950er Jahren das Bild von der Mathematik und die Wirklichkeit der Mathematik weit auseinander. In dieser Lücke wachsen science fiction und fantasy, deren Erfolg genau in dieser Zeit einsetzt. Assoziatives und bildhaftes Denken sind aus der Wissenschaft verdrängt, bleiben aber doch noch auf sie bezogen. Am klarsten und bewußtesten wird das bei Stanislaw Lem.
Anfang der 1960er Jahre schrieb er die Summa technologiae, in der Mathematik und Kybernetik eine große Rolle spielen. Er geht von der Beobachtung aus, dass im 19. Jahrhundert zahlreiche mathematische Theorien aufgestellt wurden (Boolesche Algebra, Matrizenrechnung, Differentialgeometrie), für die erst im 20. Jahrhundert die Anwendungen gefunden wurden (Kybernetik, Quantentheorie, Relativitätstheorie). Weiter geht er von der Grundlagenkrise aus, dass die Mathematik nicht durch die herkömmliche Zahlentheorie und Beweistheorie umfassend begründet werden kann. Also dreht er die Rolle der Beweisführung um und will die Mathematik von der Begrenzung auf Formeln lösen.
»Wir machen dabei genau das Gegenteil von dem, was die Mathematik bisher gemacht hat. Während sie nämlich die Leere der mathematischen Systeme mit dem materiellen der Phänomene gefüllt hat, übersetzen wir eben nicht solche Phänomene in Mathematik, sondern Mathematik in materielle Phänomene.« (Lem, Summa technologiae, S. 439)
Er denkt an Möglichkeiten, in dynamischen Prozessen etwa der Chemie mathematisch bestimmte Anfangskonstellationen zu schaffen, diese dann im chemischen Reaktionsprozeß zu belassen und als Ergebnis die mathematische Endkonstellation abzulesen. Das kann in Anlehnung an die Quantenmechanik so gedeutet werden: Jedes Experiment überführt einen Anfangs- in einen Endzustand. Dann will Lem nicht mehr nach einer mathematischen Gleichung suchen, die den gleichen Prozeß beschreibt, sondern das Experiment tritt an die Stelle der mathematischen Beweisführung. Weitergedacht (und von Lem in Also sprach GOLEM beschrieben) führt das zur Konstruktion lebender Maschinen, in denen die Unterscheidung von Hardware und Software aufgehoben ist. Mathematik wird unmittelbare Naturwissenschaft. Sie hat nicht mehr die Aufgabe quantitativer Berechnungen, die ihr vielmehr von Maschinen abgenommen werden, sondern dient dem Entwurf qualitativer Maschinensysteme. Lem bewegt sich an der Grenze dessen, was als machbar denkbar scheint. Und er bringt die Mathematik in ein gänzlich anderes Verhältnis zur Natur. Mathematik ist hier nicht mehr einfach Sprachspiel wie bei Wittgenstein, sondern Sprachspiel mit der Natur.
5. Die Zeit der Studentenbewegung
In der Studentenbewegung der 1970er Jahre gerieten mindestens 4 dicht beieinanderliegende Generationen aneinander, die nur wenig Verständnis füreinander hatten. Bei den Mathematikern lassen sie sich so charakterisieren:
Die älteren Professoren, die schon im 3. Reich geforscht und gelehrt hatten. Sie waren mit der Grundlagendiskussion groß geworden, empfanden den Bruch in der mathematischen Tradition als persönlichen Lebensbruch, konnten aber der Entwicklung der 1950er Jahre nichts entgegensetzen. Einige trugen noch Vorlesungen vor mit dem Anspruch, den Grundlagenfragen gerecht zu werden, führten also z.B. die reellen Zahlen nicht axiomatisch ein, sondern mit gewissermaßen philosophischer Begründung, und wirkten damit in dieser Zeit nur noch lächerlich und unzeitgemäß (so habe ich es in Marburg in den Vorlesungen von Vojislav Gregor Avakumovic erlebt). Sie kannten noch die Universität vor der Bildungsreform mit ihrem elitären Charakter, ihnen waren die großen Studentenmassen in den Vorlesungen und Prüfungen einfach lästig. Sie standen daher auch der Stufentenbewegung fremd gegenüber. Nur wenige zeigten offene Sympathie und verbanden mit ihr die Hoffnung auf Umwälzung der spröden Verhältnisse der 1950er Jahre.
Es folgt die Macher-Generation, die den Krieg erlebt und den "Zusammenbruch" erlitten hatten. Daraus folgte für sie ein tiefes Mißtrauen und Ablehnung jeder Weltanschauung und ein praktischer Antifaschismus, indem sie voller Energie in einer demokratischen Umgebung den Wiederaufbau leisteten. Wenn sie überhaupt einer Weltanschauung nahe standen, dann dem Positivismus und Neo-Kantianismus, und damit waren sie in Opposition zum Intuitionismus und zugleich der Verachtung durch die kritische Zivilisationskritik bei den Geisteswissenschaften ausgesetzt. In der Mathematik waren sie mehr am Fortbestand und der Demokratisierung der Institution interessiert als an bestimmten Inhalten. Demokratisierung und Aufklärung gewannen nach der Erfahrung mit dem Faschismus großes Ansehen. Nicht nur in engerem politischen Sinn wurde ein wenig die bürgerliche Revolution nachgeholt. Sie setzten die Öffnung der Hochschulen und die Bildungsreform durch, einen großen Teil ihrer Arbeitskraft steckten sie in Verwaltung und Herausgabe der Standardlehrbücher, in Organisation von Vorlesungen und Übungsbetrieb, und weniger in Forschung. Ohne überzeugte Bourbakisten zu sein, kam ihnen die französische Mathematik weit mehr entgegen als die deutsche Tradition. Im Lebensstil sahen sie eher in den amerikanischen Colleges als in der alten deutschen Universität ihr Vorbild. Mit ihnen verlor, wie es so schön heißt, die Mathematik in Deutschland den Anschluß an die Weltspitze. Der Studentenbewegung schenkten sie solange ihre Sympathie, wie sie ihr Aufbauwerk und die Bildungsreform unterstützte und Bündnispartner gegen die Konservativen waren. Als die Studentenbewegung aber weltanschaulicher wurde und der sozialliberale Regierungswechsel kam, wurden sie ihre erbittertsten Kritiker.
Die kurz vor, während oder kurz nach dem Krieg Geborenen waren die leidenschaftlichen Anhänger Bourbakis. Ohne selbst die Bildungsreform zu erkämpfen, profitierten sie von ihr. Von ihr erhielten sie die zahlreichen Professorenposten. Die verästelte Mathematik bot jedem sein Spezialgebiet, wo er forschen und Erfolge haben konnte. Niemandem ging es so gut wie ihnen, sie waren ehrgeizig, nahmen sich Zeit zur Forschung und fühlten sich am Beginn eines besseren Zeitalters. In anderen Fächern verstanden sie sich erst als Wortführer, später als Schulmeister der Studentenbewegung. In Mathematik waren sie die Wortführer für eine moderne, aufgeschlossene Mathematik, auf den internationalen Kongressen, weltoffen und interessiert an industriellen und EDV-Anwendungen, frei vom alten Muff. Unglaublich schnell in diesen hohen Lebensstandard und Erfolg hineingekommen, hatten sie naturgemäß im Grunde ein bewahrendes Interesse an den Zuständen an der Universität nach der Bildungsreform. Die Kritik durch die Studentenbewegung in den 1970er Jahren konnten sie meist nicht nachvollziehen. Fühlten sich viele in ihrer Assistentenzeit der Studentenbewegung vom Lebensgefühl her irgendwie verbunden, entfremdeten sie sich doch schnell von ihr, als sie Professoren wurden. Sie traten nicht gegen sie auf, aber sie zogen sich in ihre Forschung, auf ihre Kongresse zurück, übertrafen in den Prüfungen an Anforderungen und Unerbittlichkeit meist noch die älteren Kollegen und kamen am liebsten mit dem Ratschlag: Lernt mehr und seid erfolgreich wie wir.
Durch die Bildungsreform strömten plötzlich ungeheuer viele neue Studenten an die Hochschulen, die aus allen Nähten platzten. Alles wurde enger, voller, anonymer. Gerade in den Naturwissenschaften studierten sehr viele, deren Eltern nicht studiert hatten. Die Erwartungen waren entsprechend hoch. Den meisten hatte in der Schule Mathematik Spaß gemacht, sie hatten sich von science fiction und der Relativitätstheorie begeistern lassen, viele waren an Philosophie und Erkenntnistheorie interessiert. Gab es vorher im Grunde nur die Studienkombination Mathematik und Physik, verbanden jetzt besonders die Lehrerstudenten Mathematik mit Germanistik, Politik, Geographie oder Biologie. Mit den Lehrerstudenten stieg der Anteil von Frauen, der vorher praktisch gleich Null gewesen war. Das alles führte zu einem neuen Anspruch an das Mathematikstudium, der vom Lehrkörper bei weitem nicht erfüllt, in der Regel nicht einmal verstanden wurde.
Schon 1968 war diese Kritik zu spüren, wie aus Heidelberg ein Text von Mehdi Padamsee zeigt:
»Die Mathematik ist abstrakt und inhaltlich gesehen oberflächlich. Wenn der Mathematiker drei Äpfel sieht, beachtet er die Zahl 3 und nicht die Äpfel. Schon von dieser Methode her ist jede Tiefe der Mathematik unzugänglich. Doch wenn man sie betreibt, gewinnt sie einen Inhalt, indem man sie betreibt. Der Mathematiker bei seiner Arbeit befindet sich nicht mehr unter uns - er weilt vielleicht in irgendeinem n-dim. Raum oder setzt irgendwelche Strukturen in Relation zu anderen. Das fesselt ihn und bietet ihm zugleich eine Zuflucht aus dieser Welt, in der es zuviel Angst und Verzweiflung gibt. ... Er verachtet die Physiker und ist verärgert über die Philosophen. Wenn es aber einen gibt, der beides macht, wird er von ihm bewundert oder als ein stiller Spinner betrachtet. Er selbst hat auch einen leichten Knacks und ist stolz darauf. ... Wie steht es mit dem Mathematikstudenten? Er muß damit rechnen, dass der Professor eine Vorlesung so liest, als ob der Student gar nicht da wäre. Die Guten verstehen fast alles, die anderen gar nichts, und die sind jedem im mathematischen Seminar gleichgültig.« (Auch eine Geschichte der Universität Heidelberg, S. 417f)
Fragen der Hochschuldidaktik, Pädagogik und Studienreform standen daher im Zentrum. Klausurenboykott, Forderung nach anschaulichen Vorlesungen, Tutorien, sinnvollen Übungsaufgaben, Gruppenarbeiten, Einführung in die Berufspraxis machten bei den Mathematikern den überwiegenden Inhalt der Studentenbewegung aus. Daneben standen einige Diskussionen über Mathematikgeschichte, Philosophie der Mathematik, Mathematik in der Sowjetunion. Orientiert an den Debatten der Studentenbewegung in den humanistischen Fächern wurde die Stellung des Mathematikers in der Produktion analysiert. Industriesoziologische Arbeiten von Horst Kern und Michael Schumann am SOFI Göttingen wurden übertragen auf die künftige Arbeitsweise der Mathematiker. Der Bruch in der deutschen Tradition wurde gespürt und nach der Marx-Lektüre verstanden als der Übergang von der formellen zur reellen Subsumtion der Arbeitskraft des Mathematikers.
Alle Bemühungen um Studienreform scheiterten jedoch mit wenigen Ausnahmen an den Reformuniversitäten. Die Lehrerarbeitslosigkeit und die Perspektive der Diplom-Mathematiker in EDV-bezogenen Berufen taten ein übriges, dass die Unruhe unter den Studenten schon Ende der 1970er Jahre abflaute, als die nächste Studentengeneration viel nüchterner und realistischer an die Universitäten kam.
Trotzdem ist die Studentenbewegung nicht einfach wirkungslos geblieben. Die Dominanz der Bourbaki-Richtung ließ sich nicht halten, andere Strömungen gewannen an Boden, insbesondere Differentialgeometrie und in neuerer Zeit Künstliche Intelligenz und verwandte Gebiete (wie Graphentheorie).
In entschiedener Rückkehr zur Anschauung wurde Ende der 1960er Jahre in Frankreich von dem Bourbaki-Abtrünnigen Rene Thom die Katastrophentheorie begründet. Dies fiel zusammen mit ähnlichen Entwicklungen in der Sowjetunion und den feldtheoretischen Arbeiten in der amerikanischen Forschung. Thom schrieb 1969 programmatisch:
»Wir arbeiten hier weniger mit einer wissenschaftlichen Theorie, sondern genauer mit einer Methode. Und diese Methode führt nicht zu spezifischen Techniken, sondern streng gesagt zu einer Kunst der Modellbildung. Was sollte in diesem Sinn die tiefste Motivation für diese Modelle sein? ich glaube, sie genügen einer sehr grundsätzlichen erkenntnistheoretischen Notwendigkeit. So lange uns wissenschaftliche Gesetze und mathematische Formeln eine sehr strenge Kontrolle über die Phänomene gaben (wie in dem klassischen Elektromagnetismus), gab es keinen Grund, sich über mögliche Modelle zu sorgen, und wir können für einige Zeit unsere unbezähmbare Neigung vernachlässigen, durch Bilder die grundlegende Natur natürlicher Prozesse zu verstehen. Aber sobald wir in Schwierigkeiten geraten, in Widersprüche (wie in der Teilchenphysik) oder wenn wir uns von der Fülle empirischer Daten ohne klare Vorstellung von den Problemen überwältigt fühlen (wie in der heutigen Biologie), dann entsteht die Notwendigkeit von Leitideen, um die Daten zu klassifizieren und die signifikanten Merkmale herauszufinden. Wenn wissenschaftlicher Fortschritt etwas anderes sein soll als Versuch und Irrtum, beruht er notwendig auf einem qualitativen Verständnis der Prozesse.« (Thom, Topological Models in Biology, S. 333f)
Mit qualitativem Studium ist hier die Untersuchung von Wachstums-, Krisen- und Verzweigungsmodellen gemeint. Im Laufe der 1970er Jahre wurden Beispiele in so verschiedenen Bereichen wie Chemie, Kardiologie (medizinische Untersuchung des Herzens), Plasmaphysik, turbulenten Flüssigkeiten, Gravitation studiert. Anfangs spielte diese Richtung eine eher exotische Außenseiterposition, wird inzwischen aber schon fast zu einer neuen Weltanschauung erhoben. Aber auch sie spielt sich ganz im gewohnten institutionellen Rahmen ab, an dem die Studentenbewegung nicht wesentlich zu rütteln vermochte.
6. Mathematik im Zeichen der EDV
Auf die Diskussionen der Studentenbewegung folgte eine ziemliche Ernüchterung. Fachlich kommt es zu einer Schwerpunktverlagerung von der reinen zur angewandten Mathematik, zu einer starken Ausrichtung auf die Anwendung und Nutzung der Mathematik in der EDV. Dies ist in der Geschichte der neueren Mathematik keineswegs selbstverständlich, im Gegenteil. Trotz aller Anwendungen in der Naturwissenschaft verstanden sich die meisten Mathematiker eher als Geisteswissenschaftler. Und beruflich konnten sie auf dem Gebiet der reinen Mathematik weiterarbeiten, sei es in der Hochschule oder in einer Forschungsabteilung. Seit den 1970er Jahren sind diese Wege verbaut und außer in der EDV gibt es kaum Arbeitsmöglichkeiten.
Von der Professorenschaft wird diese Entwicklung als Bruch empfunden. In allgemeinster Weise hat sich Lyotard in seinem Bericht über das Postmoderne Wissen dazu geäußert, genauer für die Mathematik Davis und Hersh in Erfahrung Mathematik. Diese Veränderungen sind von den USA ausgegangen und bestimmen jetzt auch in Westdeutschland den Kurs.
6.1. Die Bedeutung der angewandten Mathematik, insbesondere der numerischen Mathematik, wächst enorm. Hier geht es im wesentlichen um den Entwurf und die Realisierung möglichst genauer und effektiver Methoden, riesige mathematische Gleichungssysteme mit Computerprogrammen zu bearbeiten. In der Regel werden kontinuierliche Strömungen durch Differentialgleichungen beschrieben, die dann nicht gelöst, aber angenähert werden können. So kann in Computersimulationen das aerodynamische Verhalten neuer Automodelle getestet werden, Wetterveränderungen werden simuliert oder auch Zusammenstöße ganzer Galaxien im Weltraum, Super-GAUs in Kernkraftwerken etc.
Die angewandte Mathematik erhält hier sowohl die Aufgabe, passende Gleichungssysteme zu finden, Annäherungsverfahren zu entwerfen als auch technische Wege der Realisierung zu bestimmen. Die grundlegenden Entwürfe neuer Programmiersprachen und Rechnerarchitekturen fallen zu einem guten Teil in das Gebiet der angewandten Mathematik (Graphentheorie, Petri-Netze).
Durch die Entwicklung von Programmen mit Künstlicher Intelligenz wird die Bedeutung der Mathematik weiter gesteigert. Denn in der Künstlichen Intelligenz geht es darum, komplexe Aufgabenstellungen mithilfe von Logik-Kalkülen zu lösen, und hier kann naturgemäß auf mathematische Grundlagenforschungen zurückgegriffen werden. So ist es kein Zufall, dass das Erfolgsbuch Gödel Escher Bach von Hofstadter von Fragen der Künstlichen Intelligenz ausgeht und zu Themen der mathematischen Grundlagenforschung kommt.
Durch diese Neuentwicklungen wird erstmals der starre institutionelle Rahmen der deutschen Universitäten aufgebrochen. Industrie- und Hochschulforschung werden stärker verbunden, nach dem Vorbild in den USA und England erhalten auch selbständige Software-Häuser eine gewisse Chance.
6.2. Auch in der reinen Mathematik wird mehr und mehr EDV eingesetzt, so vor allem bei der Berechnung von Werten für die Zahlentheorie. Bis in unglaubliche Größenordnungen sind alle Primzahlen ausgerechnet und statistische Untersuchungen über ihre Verteilung angestellt worden. Diese Datenvielfalt führt regelrecht zu einer Krise der klassischen mathematischen Beweistätigkeit. Nicht nur vervielfachen sich die bewiesenen Sätze ins Unermessliche, sondern es ist keine Seltenheit mehr, dass Beweise mehrere hundert Seiten lang werden und damit fast nicht mehr nachprüfbar sind. Durch die EDV-Berechnungen entsteht ein riesiges empirisches Material an Kenntnissen über bestimmte Zahlen, wo es kaum mehr gelingt, dies in mathematische Gesetze umzusetzen, geschweige denn nach neuen Axiomensystemen zu suchen, in denen sich diese Komplexität einfacher und überzeugender darstellen ließe.
6.3. Mit der anwachsenden Beweislast wird schließlich auch versucht, Computer unmittelbar für mathematische Beweise einzusetzen. Der Vierfarbensatz war ein aufsehenerregendes Beispiel. Er besagt anschaulich, dass es möglich ist, eine beliebige Länderkarte so mit vier Farben zu zeichnen, dass keine Länder mit der gleichen Farbe eine gemeinsame Grenze haben. Um das zu beweisen, wurde diese Frage in eine Vielzahl von Teilen zerlegt, die dann im einzelnen von einem Computerprogramm durchgerechnet wurden.
Mit der starken Anwendungsorientierung und dem Einsatz von Computergraphik und -simulation scheint unter der Hand die Entwicklung in Richtung Konstruktivismus und anschauliches Denken zu gehen. Es zählt ja nur, was mit Algorithmen auf einem Rechner realisiert werden kann, also konstruktive Rechenverfahren, und durch Computerbilder kann ständig auch für komplexe mathematische Fragen eine Veranschaulichung gesucht und gefunden werden. Gerade die neuen Arbeiten zur Katastrophentheorie sind voll mit Computerzeichnungen und stehen in engem Zusammenhang zur Entwicklung neuer Computergraphiken.
Gleichzeitig wird aber der Pragmatismus der Formalisten fortgeführt und fast noch verschärft, wo die Anwendungen im Gleis der Maschinenrealisierbarkeit bleiben. Die Computersimulationen basieren auf zwei Vereinfachungen:
im Ansatz der Gleichungssysteme
und in der Rechengenauigkeit
Indem sie ihrerseits zur leitenden Anschauung werden, können sie sich leicht von der Naturbeobachtung lösen und drängen die Mathematik dahin, nur noch den vorgegebenen Rahmen zu optimieren. In der Primzahlforschung zeigt sich das ganz deutlich. Primzahlen sind natürliche Zahlen, die auf der Zahlengerade angeordnet sind. Zum einen gibt es die Frage, wie viele Primzahlen existieren (insgesamt und in bestimmten Zahlenbereichen), zum anderen, ob es in der Reihenfolge der Primzahlen Regelmäßigkeiten gibt. Die Frage ist daher interessant, da angenommen wird, dass ihre Erkenntnis auch zu einem vertieften Verständnis in anderen mathematischen Bereichen führt. Bei den Eigenschaften von Primzahlen handelt es sich offenbar um mathematische Grundstrukturen. Mit der EDV sind die Möglichkeiten erheblich verbessert, immer mehr Primzahlen zu finden und ihre statistische Verteilung zu berechnen. Für die Primzahlforschung sind jedoch qualitative Methoden erforderlich.
Ein Beispiel hierfür lieferte im 19. Jahrhundert Riemann, als es ihm gelang, die Primzahlen in einer qualitativ anderen Zahlenmenge - den komplexen Zahlen - darzustellen und daraus völlig neue Erkenntnisse über ihre Verteilung zu gewinnen und die Frage nach ihrer Verteilung überhaupt neu zu stellen. Davis und Hersh bezeichnen dies als die bedeutendste ungelöste Frage in der gegenwärtigen Mathematik. Weitere Fortschritte sind wohl nur zu erzielen, wenn in diesem Sinn weiter gefragt wird. Anschaulich wäre es etwa vorstellbar, dass eine zweidimensionale Figur entworfen wird, die die eindimensionale Zahlengerade an den Punkten schneidet, wo die Primzahlen liegen. Dann wird nicht mehr nach der statistischen Verteilung auf der eindimensionalen Gerade gesucht, sondern nach den Eigenschaften dieser zweidimensionalen (oder in anderen Modellen auch mehrdimensionalen) Figur. Der Entwurf solcher Figuren erfordert natürlich eine gewisse Intuition, die über statistische Berechnungen hinausgeht.
Indem es die EDV ermöglicht, quantitative Berechnungen immer schneller und für immer mehr Zahlen durchzuführen, kann das dazu verleiten, überhaupt in Optimierungen der quantitativen Verfahren stecken zu bleiben, statt nach qualitativ anderen Wegen zu suchen. Darüber hinaus zeigt die Katastrophentheorie die grundsätzlichen Grenzen von EDV-Darstellungen, die trotz aller verbesserter Genauigkeit nur Annäherungen liefern können. Katastrophen ereignen sich gerade dort, wo auf den ersten Blick vernachlässigbar kleine Störungen sich zu Krisen und Verzweigungen ausweiten. Alle Annährungsverfahren in den EDV-Programmen beruhen aber auf der Grundannahme, dass die Gleichungssysteme nicht exakt zu lösen, sondern nur »beliebig genau« zu berechnen sind. Im Gegensatz zu den Erkenntnissen der Katastrophentheorie setzen sie voraus, dass es vernachlässigbar kleine Größen gibt, die nicht mehr berücksichtigt werden müssen.
Aber es ist auch möglich, mit den gleichen EDV-Methoden Katastrophen zu simulieren. Es kann gezeigt werden, wie es zu Katastrophen kommen kann. In anderen Modellen wird wiederum im Ansatz der Katastrophenfall ausgeschlossen. So entsteht eine Beliebigkeit. Der Nutzen der EDV besteht dann nur darin, dass durchgerechnet werden kann, zu welchen Konsequenzen bestimmte Vorgaben führen. Ob diese Vorgaben mit der Realität übereinstimmen, ist eine andere Frage.
Nachdem die Grundlagendiskussion zunehmend dogmatisch geworden war, führt der EDV-Einsatz in jedem Fall zu einer Vielzahl neuen empirischen Materials für die mathematische Forschung und belebt ausgehend von der Künstlichen Intelligenz auch die Grundlagenforschung neu. Trotz der verführerischen Möglichkeiten, qualitative Forschung aufzugeben und Simulationen mit der Realität zu verwechseln (einschließlich der möglichen politischen Konsequenzen etwa beim Bau von Kernkraftwerken oder im SDI-Projekt), ist diese neueste Entwicklung daher keineswegs nur negativ zu beurteilen.
Literaturhinweise
1986
© tydecks.info 2002