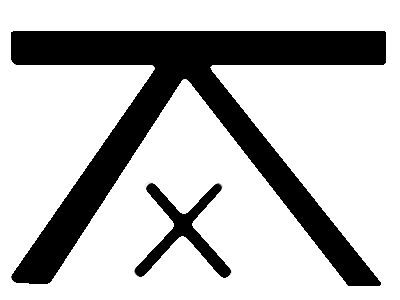Walter Tydecks
Tonos – die Kunst des Hörens
- Von tonos (Spannung, Tonus, Ton, Intention) zum symbolischen Klangleib und seiner Gefährdung
Aristoteles hat immer nach einer Antwort auf die rhetorische (sophistische) Herausforderung gesucht. Mit rhetorischen Figuren soll der Ansprechpartner voreingenommen werden, bevor es überhaupt zur Entwicklung einzelner Gedankengänge kommt. Er soll überzeugt sein, bevor er so recht weiss, wovon. Das gelingt dem Rhetoriker, wenn er eine bestimmte Spannung zu erzeugen vermag, die aus sich heraus zum gewünschten Ergebnis drängt. Alle Worte werden dadurch vorgeprägt, erhalten eine eigene Färbung, ohne dass sich dies an einem einzelnen Wort oder Satz analytisch nachweisen ließe. Die Syntax bleibt in der Luft hängen. Alle Bemühungen von Aristoteles, mithilfe der Analytik und Topik den Methoden der Sophisten auf die Spur zu kommen und ihre Argumentationsweise zu durchschauen, blieben daher unbefriedigend. Statt weiter nach der Kunst und der inneren Ordnung des Sprechens und den Elementen der Sprache (logos) zu fragen, soll daher umgekehrt nach einer Kunst des Hörens gefragt werden, die solche Manöver wahrzunehmen vermag.
Zunächst sollen die Bedeutungsvielfalt und die Entwicklungswege des Begriffs tonos beschrieben werden, die zum Verständnis der inneren Krise und Bewegtheit dieses Begriffs führen, um anschließend die wichtigsten Schlüsselbegriffe der aristotelischen Physik unter diesem Aspekt neu zu interpretieren. Denn die Physik war Aristoteles' Antwort auf die Sophisten, mit der er einen eigenen Zugang zur Philosophie gewinnen wollte, frei von ihren verwirrenden Schein- und Trugbildern. Niemand hat das besser verstanden als der große Rhetoriker Heidegger.
Tonos ist das Substantiv zum Verb tenein mit der Bedeutung »strecken, ziehen, spannen, straffen«. Aus ihm entwickelte sich in allen europäischen Sprachen der vieldeutige Begriff Ton: musikalische Tonhöhe in einem Tonsystem, Tonalität, aber auch im Sinn von Umgangston, echter oder unechter Ton, vornehmer Ton, Zwischen- und Untertöne, die im Unterschied zum ausgesprochenen Wort die wahre Botschaft enthalten.
Medizin
Tonus ist ursprünglich ein Fachausdruck der Medizin und meint den Spannungs- bzw. Erregungszustand eines Gewebes, Muskels (Muskeltonus), des Blutgefäßsystems (Herz-, Gefäßtonus), des vegetativen Nervensystems (Sympathikotonus, Vagotonus). Der Begriff wird in Lehrbüchern sehr differenziert beschrieben.
»Muskeltonus ist teils der Widerstand eines Muskels gegen Formveränderungen, teils ein Ruhezustand innerer Spannung. Es fehlt diesem Begriff jedoch eine einheitliche klinische und physiologische Definition (Ganong, p. 56)! Klinisch bedeutungsvoll ist der Reflextonus (bei intakter Innervation bestehender basaler Kontraktionszustand). Pathologische Steigerungen führen zu Spastizität, Rigidität oder Klonus. Reversible Verkürzung der Muskelkontraktur kann z.B. durch Kälte, Säure oder Strom hervorgerufen werden; metabolische Störungen können z.B. bei Dauermuskelleistungen oder übermäßiger Anhäufung von Metaboliten zu einer Ermüdungs-Kontraktur führen. Irreversible Starre bewirkt die postmortale Starre ('Rigor mortis')« (Zuschrift von Frank Georg Bechyna mit zahlreichen weiteren Hinweisen auf die Verwendung von Tonus in der Psychiatrie, 2008).

Pablo Picasso: Der Alte Mann und die Gitarre (Blaue Periode, 1901 - 1904).
Farbe und Haltung erzeugen einen Ton, der nicht zu hören ist. Sie zeigen den Charakter und die Stimmung des alten Mannes, in dem Picasso seine eigene innere Verzweiflung gestalten wollte, in der er sich zu dieser Zeit befand. Er hat in dieser Zeit Stilelemente gefunden, die seine Bilder zeitlebens prägen, seinen eigenen Ton.
Urheber: By Pablo Picasso - The Art Institute of Chicago and jacquelinemhadel.com, PD-US, Link
Ausgehend von dieser Grundbedeutung wird der Begriff tonos auf andere Bereiche übertragen. Wird nicht mehr der Tonus eines einzelnen Körperteils, sondern des gesamten Körpers gemeint, gibt es den speziellen Ausdruck hexis, lateinisch übersetzt Habitus, deutsch übersetzt Haltung, Gehabe. Habitus hat im deutschen Sprachgebrauch eine eigene Bedeutung bekommen, die mal eine erstarrte und oft überhebliche Art meint, etwas darstellen zu wollen, oder verinnerlichte, ja verkörperte »Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungschemata« (Gerhard Fröhlich). Das kann eine angewöhnte charakteristische Körperhaltung sein, oder auch lebenslang gebrauchte typische Gesten, etwa eine bestimmte Art zu grüßen oder zu gehen, die einem unmerklich auf den Leib geschrieben sind und vom äußeren Schema her erkennbar machen. Das ist dem Betreffenden meist unbewusst, ruft bei Außenstehenden aber häufig den ersten Persönlichkeitseindruck über ihn hervor. Der Habitus ist nicht mit der allgemeingültigen Körpersprache zu verwechseln, gibt ihr aber eine persönliche Note. Ein guter Rhetoriker versteht es, sich einen überzeugenden Habitus anzueignen und dadurch eine persönliche Wirkung auszuüben, die seinen wahren Absichten zuwiderlaufen und sie verbergen kann. - Siehe hierzu ausführliche Studien von Pierre Bourdieu, zusammengefasst von Gerhard Fröhlich.
Nur in dieser Bedeutung wollte Aristoteles tonos gelten lassen und nahm hexis in sein philosophisches Wörterbuch auf (Met. V 20, 1022b). Mir ist jedoch nicht bekannt, ob er diesen Begriff in seiner Kritik an Rhetorik und Sophisterei einbezogen hat.
Physik
Zu einem Grundlagenbegriff der Physik wurde tonos bei den Stoikern. Für sie ist der Tonos das Pneuma der Dinge und durchzieht als ein inneres Bewegungsprinzip die Welt von starren Dingen (Steinen), Pflanzen, beseelten Lebewesen bis zum Göttlichen. Im Hintergrund steht eine Naturphilosophie, dass die Welt aus elementaren, verdrillten Saiten und nicht aus Punkten und Elementarfiguren aufgebaut ist.
Nachdem es sich als unmöglich erwiesen hat, die Physik nach dem Vorbild der euklidischen Geometrie aus punktförmigen Elementen zu begründen, gewinnt dieses Verständnis in der modernen Naturwissenschaft immer mehr Einfluss. William Hamilton hat als erster bereits in den 1840ern eine Neufassung der Mechanik gesucht. Er führte nach dem Vorbild der komplexen Zahlen die Quaternionen ein, die vergleichbar der Ebene der komplexen Zahlen einen vierdimensionalen Raum mit einer eigenen Algebra begründen. Das Maß der Quaternionen nannte er Tensor, abgeleitet vom lateinischen Wort tendere, »spannen«. Im weiteren wurden dann in allgemeinerer Bedeutung Tensoren eingeführt, um in physikalischen Räumen jedem Punkt eine besondere physikalische oder Raumeigenschaft zuzuschreiben, so z.B. der Spannungstensor (eine Verdoppelung des Begriffs Spannung). Einsteins Gravitationslehre setzte intensiv auf eine Tensoranalysis, eine Beschreibung der Krümmungen (Verspannungen) des Raumes.
Aber es erwies sich auch dann als unmöglich, die moderne Physik widerspruchsfrei zu beschreiben, wenn jedem Punkt ein Tensor zugeordnet wird. Daher wird seit 1970 diskutiert, den Punkt als kleinste Einheit des Raumes ganz aufzugeben zugunsten von strings oder Superstrings (Stringtheorie), deren innere Spannung von sich aus bereits einen Grundton enthält, aus dem dann die komplexeren Symmetrien wie Obertöne entwickelt werden können. Das ist unverkennbar dem Grundverständnis der stoischen Naturphilosophie sehr nahe. Heute kommt hinzu, dass die Symmetrieeigenschaften gesucht und in bestimmten Algebren dargestellt werden sollen. (Meine Vermutung ist, dass die äußere Algebra mit ihrer Verknüpfung kommutativer und anti-kommutativer Elemente zu einer mathematischen Lösung führen kann.)
Musik
Einen ganz eigenen Weg ging der musikalische Begriff des Tons. Bei den Griechen waren Ton und Sprache noch nicht in der Weise voneinander getrennt, wie es heute üblich ist, so dass heute mit dem Begriff Ton ganz andere Vorstellungen verbunden werden als seinerzeit. Die Griechen kannten noch keine getrennten Aufzeichnungen für Sprache und Töne. Für ihr Sprach- und Musikverständnis reichte es aus, dem natürlichen Sprachfluss und den wenigen Versmaßen und rhetorischen Figuren zu folgen. Texte wurden - wie auch in der hebräischen Lithurgie - grundsätzlich laut gelesen und fast gesungen, die Melodie ergab sich von allein und musste nicht extra mit Noten aufgeschrieben werden. Das war möglich, so lange dem eigenen Rhythmus und Ausdruck der griechischen Sprache vertraut werden konnte. »Das griechische Wort hatte einen festen Klangleib; es hatte einen musikalischen Eigenwillen« (Georgiades, Musik und Sprache, S. 4). Sprache und Musik waren nicht getrennt. Für diese Zusammengehörigkeit gab es das übergreifende Wort musike. Georgiades sieht für diesen Begriff kein Analogon sonstwo im Abendland.
Die musike begann aber bereits bei den Griechen seit dem 4. vorchristlichen Jahrhundert mit der Entstehung einer rein sprachlichen Prosa auseinanderzufallen, die sich vom sakralen Gesang unterscheidet. Der Übergang liegt ungefähr bei Pindar. »Die Sprache wurde in der Handhabung der musikalisch-rhythmischen Komponente stets unsicherer, der musikalische Klangleib stets schattenhafter, bis er ganz verschwand« (ebd., S. 5). Als die Sprache nicht mehr aus sich selbst heraus sang, mussten eigene Regeln gefunden werden, das sakrale Wort zum Singen zu bringen. Das sakrale Wort »verlangt einen musikalisch festgelegten Vortrag. Das ist die Geburtsstunde der abendländischen Musik« (ebd., S. 7).
Kritisch wurde diese Entwicklung jedoch erst, als mit der Ausbreitung des Christentums die griechische Lithurgie auf die nord- und westeuropäischen Sprachen mit ihrem eigenen Sprachrhythmus übertragen wurde. Musikalische Regeln und gesprochenes Wort passten hier nicht mehr zueinander (siehe dazu die Lehre der Prosodie). Daher mussten verbindliche neue Notationsweisen gefunden werden, um Worte und Töne getrennt aufschreiben und durch die graphische Darstellung äußerlich miteinander verbinden zu können. Zu jedem Wort musste beschrieben werden, wie es zu singen ist, da in der anderen Sprachumgebung das vertraute Sprachverständnis nicht weiterhalf. Später kamen spezielle Zeichen für die musikalische Dynamik hinzu. So entstand ein völlig neues Verständnis des musikalischen Tons.
Das änderte radikal die Musik. Waren erst einmal die Töne konsequent von der Sprache isoliert, wurde es möglich, jedem Wort gleichzeitig mehrere Töne zuzuordnen. So entstand die Mehrstimmigkeit, und mit ihr fanden Intervalle wie die Terz Eingang in die Musik, die bei den Griechen als barbarisch empfunden und abgelehnt worden war. Mit der Terz wurde es wiederum möglich, die Dur-Tonarten zu begründen und die klassischen griechischen Tonarten aufzugeben, die heute nur noch als »Kirchentonarten« weiterleben.
Die synchron vorgetragenen verschiedenen Stimmen wurden immer selbständiger. Die hohe Kunst der Komposition bestand nun darin, sie optimal aufeinander abzustimmen (Kontrapunktik). Dadurch eroberte sich die Musik buchstäblich eine neue Dimension, die mal als Farbe (Chromatik) und mal als Räumlichkeit bezeichnet wird. Die Musik kennt nicht mehr nur die sich zeitlich entwickelnde Melodie, sondern in jedem einzelnen Zeitmoment die auf inneren Symmetrien beruhende Klangfarbe. Unterschiedliche Instrumente und Stimmlagen werden bewusst eingesetzt, um einen schönen Zusammenklang zu erzielen. Sie werden wohlüberlegt räumlich aufgestellt, damit ein perfekter Raumklang entsteht. Ursprünglich saßen die verschiedenen Stimmen der Gesangsgruppen in räumlich verteilt postierten Chören in der Kirche, daraus entwickelte sich später die Sitzordnung der Orchester. Die reine Instrumentalmusik konnte sich vom Gesang emanzipieren und die Töne völlig von der Sprache lösen.
Im Ergebnis ist das kleinste Element der Musik nicht mehr der vom Menschen gesprochene oder gesungene Ton, sondern dessen Zerlegung in Grundton und Obertöne. Damit wurde mathematisch beschreibbar, wie der gleiche Ton auf unterschiedlichen Instrumenten verschieden klingt (Klangfarbe) entsprechend der für jedes Instrument charakteristischen Verteilung von Grund- und Obertönen. Das klassische System der 8 Töne mit seinen mathematischen Intervallen wurde ersetzt durch die neue Harmonielehre von Rameau. Das Klavier wurde wohltemperiert, um völlig frei modulieren zu können, das heißt, die verschiedenen Töne sind nicht mehr entsprechend den Naturtönen geordnet, sondern gegenüber ihrer natürlichen Lage leicht verschoben, um eine mathematische Gleichverteilung zu erreichen.
Dadurch wurde eine im Prinzip unendlich variierbare Tonwelt geschaffen, die sich weit entfernt vom Klangraum der wenigen den Griechen bekannten Grundtöne. Die Kompositionslehre wird auf mathematischen Gesetzen statt auf der Wahrnehmungsästhetik aufgebaut, auch wenn es zwischen beiden noch gewisse Beziehungen gibt. Die Bindung der Musik an das Schönheitsempfinden des Gehörs ist aber im Prinzip aufgehoben. Es wird ein »mathematisches«, intellektuelles Hören verlangt, das den Einsatz der Kompositionsmethoden erkennt und versteht, statt eines gefühlsbetonten Musikempfindens. Bis heute ist es nicht gelungen, neue und allgemein anerkannte Schönheitsgesetze für die Musik zu formulieren. Die Musik wurde zum Vorreiter der Abstraktheit und des fortwährenden Experimentierens mit neuen Klangmöglichkeiten und damit zum Modell der modernen Naturwissenschaft. Quantenmechanik und Teilchenphysik bilden das Verständnis von Grund- und Obertönen nach, wenn jeder Zustand durch eine bestimmte Verteilung in einem Raum definiert ist, der sich aus dem Grund- und seinen Obertönen zusammensetzt. Jeder Zustand wird daher mathematisch wie eine Klangfarbe bechrieben.
Statt eines Tons läßt sich zutreffender von einem »Klangleib« und seinem Tonus sprechen. Uhde und Wieland schreiben: Interpretatorische Arbeit beginnt und endet mit dem richtigen Klang, den treffenden »Klangleib«.
»Seine Plastizität resultiert aus jener Innenspannung, dem klanglichen 'Tonus', der einem musikalischen Charakter erst seine konkrete Gestalt gibt. Der Musiker kennt etwas wie eine Klangachse, das innere Maß des je charakteristischen Klanges, auf das sich die Klangfarben und dynamischen Extreme beziehen müssen wie Rubati auf das Grundtempo. Wo diese Einstellung auf den spezifischen Klangtonus nicht zuvor innerviert wurde, wo die Klangachse verloren geht, gerät das Ganze nicht weniger haltlos als bei Verlust der Tempoachse« (Uhde, Wieland, S. 470).
Nicht nur jedes wertvolle Musikinstrument, sondern auch jeder bedeutende Interpret hat seinen eigenen, unverwechselbaren Ton. Die Hörer haben eine Neigung, in der gehörten Musik für sich einen erwünschten oder unerwünschten Ton wahrzunehmen, so dass sich nur noch schwer unterscheiden lässt, in welchem Maß sie entsprechend ihren eigenen Erwartungen oder der Interpretation folgend hören.
Der Hörvorgang gewinnt eine eigene Bedeutung für das Hören. Nicht nur der Musiker muss in der richtigen Stimmung sein, das Stück spielen zu können, sondern vom Hörer ist eine große Aufnahmebereitschaft verlangt. Die Hörsituation kann einen prägenden Einfluß haben. Es ist nachgewiesen, dass zufälliger oder bewusster Höreindruck nach schwersten Traumata eine besonders intensive, lang andauernde Wirkung hat. Jeder kennt die Erfahrung, welch große Nachwirkung Musik hat, die in kritischen Lebenssituationen gehört wurde (heute definieren sich ganze Generationen von Jugendlichen nach der Authentizität »ihrer« Musik).
Der Tonus eines symbolischen Leibs
Damit ist der weite Weg beschrieben, den der musikalische Ton aus der Zeit des Aristoteles bis heute gegangen ist. Musik bekommt einen eigenen Klangkörper. Das ist nicht mehr der Körper des jeweiligen Instruments, das zum Klingen gebracht wird, sondern im übertragenen Sinn der Körper der vielstimmigen Musik selbst, der durch die Musik beseelt wird, eine symbolische Form im Sinn von Cassirer. Komposition und Interpretation können den »Tonus« des symbolischen Körpers der Musik beleben. Und so wie aus den Instrumentenkörpern und ihrem Spiel der symbolische Körper der Musik gebildet wird, bildet die Seele aus dem menschlichen Körper und seiner Motorik einen symbolischen Körper, den Leib.
Nicht nur der Klangleib, sondern jeder Leib hat einen Tonus, der dem Tonus des Körpers im medizinischen Sinn und der Körperhaltung (hexis) entspricht. Der Leib kann ebenso »verspannt« sein wie der Körper. Diese Störungen werden von der Psychiatrie intensiv analysiert (Intentionalitätsstörungen). Die symbolischen Körper der Musik und der Seele können in Resonanz kommen. Dies erklärt die tiefe Wirkung der Musik, gerade auch dort, wo der seelische Körper verletzt ist und die Musik zum Klingen bringen kann, was der menschliche Körper an Ausdrucksfähigkeit verloren hat (»Verlust des intentionalen Spannungsbogens«). Nicht ohne Grund bekommt Musiktherapie eine immer größere Bedeutung.
Die Kunst des Hörens geschieht auf der symbolischen Ebene, wenn nicht einfach das Ohr des Hörers die Rede oder die Musik in einem physikalisch beschreibbaren Prozess Ton für Ton und Wort für Wort wahrnimmt, mathematisch zerlegt und an das Gehirn weiter gibt, sondern wenn der Klangleib bzw. der Sprachleib der Kunst aufgenommen werden und eine Erregung des seelischen Leibs auslösen. Die Kunst der Rhetorik kann daher nur unvollständig erfasst werden, wenn ihre einzelnen Figuren analysiert und die sprachlichen Fallen unbestimmter Bedeutungen aufgedeckt werden. Sie wirkt über die symbolische Ebene, läßt die Seele im Ganzen erzittern und vermag deren innere Brüche anzusprechen. Das ist von besonderer Gewalt, wenn die seelischen Verletzungen unter einem Tabu stehen und der Hörer unbewußt einem Zwang unterliegt, nicht bewusst wahrzunehmen, was auf dieser Ebene wirkt. Nicht einzelne Worte oder Töne sind magisch, sondern der Tonus des symbolischen Leibs von Sprache und Musik.
Das ist der Punkt, an dem Aristoteles in seiner Kritik an der Rhetorik und den Sophisten an eine Grenze stieß (auch wenn er mit seinem Begriff der katharsis dem Verständnis bereits sehr nahe kam). Er hat aber mit dem Begriff des Zusammenhangs (syneche) einen eigenen Begriff entwickelt, der in seiner Philosophie den Platz von tonos einnimmt. Ausgehend von der späteren Tradition der Aristoteles-Kommentare durch die Neoplatoniker soll dieser Begriff der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit seiner Physik werden.
In der mathematischen Physik wird formal die Möglichkeit eröffnet, nicht nur die Punkte durch Strings zu ersetzen, sondern den Tonus des symbolischen Leibs nachzubilden. Das geschieht in der Lie-Theorie und den geometrischen Methoden der Theorie der Differentialgleichungen, wenn nicht nur in dem tragenden Raum, sondern auch in den angehefteten Faserbündeln nach inneren Symmetrien und Figuren gesucht wird (Lie-Algebren). Wenn in weiteren Kommentaren die aristotelischen Begriffe von Ort und Zeit betrachtet werden, wird damit auch die Absicht verfolgt, diese mathematischen Ideen aufzugreifen, zu verstehen und ihnen möglicherweise eine andere Grundlage zu geben.
Hier ist nochmals auf die Stoa zurückzukommen. Ihr Begriff des Pneuma kann als Oberflächenspannung verstanden werden. Von der Oberflächenspannung geht eine eigene Wirkung aus, die den umspannten Körper bildet und zusammenhält. Gilles Deleuze hat das der Stoa folgend in Logik des Sinn zu einer Theorie »von der doppelten Kausalität« verallgemeinert: Neben den üblichen Ursachen kann die Oberflächenspannung als eine zusätzliche »Quasi-Ursache« verstanden werden. Deleuze entwickelt eine weitgreifende Theorie, die die Oberflächenspannung als Sinn versteht und zu einer mathematisch orientierten Idee eines transzendentalen Feldes verallgemeinert. So weit ich ihn bisher verstehe, scheint sein Begriff des Sinns eine ähnliche Bedeutung zu haben wie das, was ich mit symbolischem Leib meine. Manuel DeLanda hat wiederum in Intensive Science and Virtual Philosophy einen ersten Ansatz entwickelt, dies auf die mathematische Theorie der Faserbündel zu beziehen. Er interpretiert die Oberflächenspannung und die Wechselwirkungen (Resonanzen) ihrer Klangachsen als das Virtuelle. Darauf ist zurückzukommen, wenn der aristotelische Begriff des Zusammenhangs und seine Bedeutung für die Klärung der physikalischen Grundbegriffe genauer analysiert sind.
Sprache
Musste im Gegenzug die Sprache verkümmern und zurückbleiben, als der Ton sich von ihr getrennt hatte und in der abendländischen Musik einen unvergleichlichen Aufschwung nahm? Zunächst einmal konnte sie von den Sophisten und Rhetorikern besetzt und ausgebeutet werden. Getrennt von der innigen Beziehung zur Ausdruckskraft des Gesangs fiel sie in einen Leerraum, den die Rhetoriker für ihre Zwecke füllen konnten. In dem Maß, wie die Sprache monotoner und ausdrucksärmer wurde, gingen Eindeutigkeit und Stimmigkeit der Aussage verloren, und jedes Wort konnte böswillig umgedreht und gegen die Intention des Sprechers gewendet werden, bis dieser an seiner Sprachfähigkeit verzweifeln musste. Aristoteles ist allen diesen Tricks mit größter Geduld nachgegangen und hat sie aufgedeckt. Aber das konnte nur eine formale Kritik sein, die im täglichen Umgang mit der Sprache nur bedingt hilfreich ist. Die Sprache wurde immer bewusster und geschickter als Instrument eingesetzt. Was Aristoteles mit seiner rationalen Kritik nicht auflösen konnte, hat im 20. Jahrhundert mit größter Treffsicherheit der (Anti-)Psychiater Ronald Laing beschrieben, als er den »Knoten« der Sprache nachging. In sozialen Systemen können von Peer-Groups alle einzelnen Aussagen mit doppeldeutigen Effekten aufgeladen werden, um Einzelne in Außenseiter-Rollen zu drängen, in der sie sich in doublebind-Rollen verfangen und auf technische Sprachen zurückzuziehen versuchen (davon soll ausführlicher eine weiter ausgearbeitete Version der Mathematik des Bösen handeln).
Doch es ist eine viel zu einseitige Sichtweise, die Sprachkunst und das Sprachverständnis der Sophisten auf ihre Herrschsucht in der Kunst der Überredung und sprachlichen Verführung zu beschränken. Im Grunde reagierten sie nur auf die Krise der Sprache, und viele waren durchaus innovativ und entdeckten ganz neue Möglichkeiten. So wie der Ton unabhängig von der Sprache eine ganz neue Farbigkeit und Vielfältigkeit gewinnen konnte, erschlossen sich auch der Sprache völlig neue Felder, als sie nicht mehr an den zeitlichen Ablauf des Gesangs gebunden war. Die Rhetoriker entdeckten die inneren Bezüge der Wortbedeutungen, eine abstrakte Begriffswelt in einem Raum mit eigenen Gesetzen, die Topik, in heutiger Sprechweise die semantischen Netze. Bei aller Kritik an der Rhetorik der Sophisten war Aristoteles keineswegs blind dafür, sondern hat im Gegenteil die Lehre der Topik begründet.
Mit der Aufklärung schien das aristotelische Programm verwirklicht zu werden. Die Aufklärer wollten mit den neuen Entwürfen einer universalen Sprache die Sprache endgültig von allen Doppeldeutigkeiten säubern und befreien. Die Sprache sollte endgültig als Herrschaftsinstrument entmachtet werden. Die Aufklärer erkannten völlig zurecht, dass ihre Demokratisierungsabsichten und ihre Forderung einer allen zugänglichen Bildung mit der Aussicht auf Chancengleichheit verpuffen mußte, wenn nicht verhindert werden kann, dass sich über den Spracheinsatz neue Abhängigkeitsmuster entwickeln. Genau das ist in der Folgezeit geschehen, und die Aufklärer waren gegenüber dieser Entwicklung ähnlich machtlos wie Aristoteles gegenüber den Sophisten.
Die neue Sprachkunst war mit Hölderlin aus dem Inneren der Aufklärung hervorgegangen. Bis heute hat die Tradition der Aufklärung keinen Weg gefunden damit klar zu kommen, und im Gegenteil konnte ausgerechnet Hölderlin zum Idol der anti-aufklärerischen Bewegung in Deutschland werden. Er hatte für die Sprache auf ähnliche Weise eine innere Dimension zurückerobert wie es zuvor der Musik gelungen war und schuf ihr gewissermaßen einen eigenen Sprachleib, der dem Klangleib der Musik entspricht. In seinen Folio-Heften ist in den übereinandergeschriebenen Gedichten und ihren unterschiedlichen Versionen eine Art sprachliche Kontrapunktik entstanden. Das war der Beginn der Revolution der poetischen Sprache (Kristeva), einer neuen graphischen Sprache, des Auseinanderbrechens der überlieferten Versmaße, die bis dahin der Sprache Halt gegeben hatten. Hölderlin hat wieder in die Geheimnisse der Sprache von Pindar zurückgefunden, als Sprache und Ton in die Krise ihrer Trennung gerieten, und von da ausgehend eine neue Sprache geschaffen, einen neuen Ton des Gedichts, die er mit gutem Recht als Gesänge bezeichnete, Gesang nun in übertragener Bedeutung, Nachtgesänge (siehe hierzu den Hölderlin gewidmeten Beitrag Kein Schutz vor der Entmächtigung des Wortes). (In ganz ähnliche Richtung wie Hölderlin ging der von der deutschen Romantik beeinflusste Edgar Allen Poe, siehe seine Schriften zum Versmaß und die Poetik.)
Intention
Auf einem nochmals anderen Weg vollzog sich die Wandlung des philosophischen Begriffs tonos. Bei Syrian fand der Begriff der Stoiker Eingang in die Aristoteles-Kommentare. Syrian lebte ungefähr 400 - 450, leitete die Akademie in Athen und war der Lehrer von Proklos. Er verstand den Raum als »eine Art vergeistigtes stoisches Pneuma, das von Spannung geladen ist« (Böhm Philoponos, S. 104). Allerdings hat er nicht die Grundbegriffe der aristotelischen Physik in diesem Sinn neu interpretiert. Ihm ging es um eine Zusammenschau der antiken Philosophie, als sie bereits massiv unter den Druck der christlichen Staatsreligion geraten war.
Trotz aller Kritik an der heidnischen Antike gewann das neuplatonische Philosophieren großen Einfluss auf die christliche Scholastik. Großzügig wurden die griechischen Begriffe ins Lateinische übersetzt und mit verwandelten Bedeutungen versehen. So wurde aus tonos die intentio. Das ist ursprünglich der Eindruck eines Gegenstands im Bewußtsein, wodurch das Bewußtsein auf den Gegenstand aufmerksam wird und sich ihm zuwendet. Wie bei so vielen Begriffen wurde auch für den Begriff intentio mit der Neuzeit die Blickrichtung genau umgedreht: Mit Intention ist heute gemeint, dass das Bewußtsein sich von sich aus einer Sache zuwendet und sich darauf konzentriert. Beiden Interpretationen ist jedoch gemeinsam, dass durch die Intention eine Ausrichtung auf ein Gegenüber erfolgt, sei dies nun ein echter Gegenstand, ein Antlitz, zu dem Blick- und Gesprächskontakt hergestellt wird, ein psychisches Phänomen (Wünsche, Erwartungen) oder eine philosophische Diskussion, wenn in der Ausdrucksweise von Heidegger Themen »in den Blick genommen« werden.
Es blieb nur noch ein letzter Schritt, um den tonus über die intentio bis zum neuen Verständnis der Intentionalität bei Brentano, Husserl, Heidegger und Merleau-Ponty zu führen. Damit lassen sich alle Fragen aufwerfen, die seither die innere Spannkraft der Spannung, die innere Krise des Begriffs tonos bestimmen, wodurch ihre innere Bewegtheit (kinesis) gesichert ist und sie zu einem vollwertigen Begriff im Sinne der aristotelischen Metaphysik wird.
Intentionalität wird als ein existenzielles Grundverhältnis des Menschen zur Natur verstanden. Es ist die Fähigkeit des Menschen, sich der Natur zuwenden und von ihr ansprechen zu lassen. Mit diesem philosophischen Begriff soll der Punkt getroffen werden, der bei der Wahrnehmungsfähigkeit über die bloße Wahrnehmung von sinnlichen Reizen hinausgeht. Kritiker der Künstlichen Intelligenz sehen in der Intentionalität präzise den Unterschied des Menschen zu jeder Art von Maschine, die von keiner Intention geleitet wird, sondern nur von fest vorgegebenen Programmen, die auf bestimmte Muster von Reizen reagieren.
Der voll entfaltete Begriff tonos
(1) Umgangssprachlich ist Tonus ein Spannungszustand, zum Beispiel eines Muskels, und zeigt sich in der Körperhaltung eines jeden Menschen. Und auch alle Dinge haben eine spezifische Oberflächen-Spannung, ihre Steifigkeit, Starre, Elastizität, Neigung zum Zerfließen oder sich in Luft aufzulösen.
(2) Übertragen ist es die Intention, die in unterschiedlichen Graden fixierende, zerstreute oder ermutigende Ausrichtung auf einen Gegenstand oder einen Gespächspartner, die erregte Aufmerksamkeit, Konzentration. Mal kann etwas auf sich aufmerksam machen, mal kann die eigene Intention gegenüber den unterschiedlichen Eindrücken festgehalten werden und das suchen, was der Intention entspricht und die eigene Intention in einem schwierigen Umfeld durchhalten läßt.
(3) So wird Intention von existenzieller Bedeutung und zeichnet das Physische in seiner ursprünglichen Bedeutung aus (was aus sich selbst heraus wächst, sich in der Umgebung orientiert und die eigene Natur durchhalten und entfalten will) gegenüber dem Technischen (was durch fremde Einwirkung entsteht): Physisches ist mit Intention begabt, Technisches nicht.
(4) Und doch stößt die Intention an zwei Grenzen: Auf die unerklärliche Faktizität der Dinge, die einfach hingenommen werden müssen, nur benannt werden können, ohne ihre Intention zu verstehen. Das musikalische Tonphänomen wird sich als solches Faktum erweisen. Und sie kann von innen gestört sein durch eine Trübung der Fähigkeit, aufmerksam sein zu können. Das kann durch psychische, gesellschaftliche oder religiöse Spannungen verursacht sein und äußert sich in Konzentrationsschwäche, fehlender Motivation, »alles ist langweilig«, leerlaufender Hyperaktivität etc. Vermittelt über Merleau-Ponty übernahm die Psychiatrie in diesem Sinn den Begriff der Intention (»intentionaler Bogen«).
(5) Durch solche Erfahrungen zeigt sich die innere Kraft des Tonus. Sie muss dem Menschen mitgegeben sein und von ihm ständig neu aufgebaut werden und erreicht dann eine eigene innere stabilisierende Kraft, die als Glück erfahren wird. Es gibt eine eigene innere Kraft und Ausstrahlung des Zusammenhangs (Zusammenhalt). Wird sie verfehlt, führt das zu Stress (Verspannung) und schlägt um in eine negative Sog-Wirkung, die den Menschen immer weiter abtreibt von einer glückenden Intentionalität und stattdessen entgleitenden Süchten ausliefert.
(6) Kann der Zusammenhang aufrecht erhalten werden, entstehen ein eigener symbolischer Körper, ein Leib, und seine beseelende Kraft, die Psyche. Das gilt für jeden einzelnen Menschen, und für die vom Menschen geschaffenen Kulturtechniken, die Musik und die Sprache, die ihren eigenen Klangleib bzw. Sprachleib haben. In der Ausdrucksweise von Aristoteles verwirklicht sich damit die Natur (physis) des Menschen, der Musik, der Gesellschaft.
(7) Der echte Ton der Musik gelingt aus der Spannung der beflügelnden Musen und des inspirierten Musikers. Diese Spannung kann sich objektivieren in Systemen wie der Tonalität ohne je ganz darin aufzugehen. Die Erfahrung der Musik kann das viel besser zeigen als viele Worte. Für diese Art von Ergriffensein wurden immer Bilder an der Grenze zu religiösen Erfahrungen gesucht. Philon von Alexandrien sah in der Ausbreitung des Gotteswortes die tonike kinesis, die innere Bewegtheit der Spannung. Der Begriff tonos enthält ein dunkles Moment. Das kann ihm vorgeworfen werden oder dazu führen, diesen Begriff ganz aufzugeben oder ihn auf eine reduzierte Bedeutung herabzustufen, aber es kann auch ein Weg sein, das Dunkel besser zu verstehen.
(8) Die Kunst des Hörens kann die höchste Entfaltungsstufe, aber auch die Krise des Tons zeigen. Mit der Entwicklung der musikalischen Möglichkeiten musste auch das Hören feiner und wacher werden. Zum vollen Verständnis der immer komplexer werdenden Werke wurde ergänzende theoretische Beschäftigung mit der Partitur und der Musikgeschichte und -soziologie notwendig, bis im 20. Jahrhundert der Konsens über Harmonie und Schönklang verloren ging, und das Ohr zugleich wachsendem Dauerstress durch industriell erzeugten Lärm ausgesetzt ist. Hörstörungen und -krankheiten häufen sich, gerade auch bei Musikern. Ohrenbetäubende Musikrichtungen entstehen, Musik kann Suchtcharakter annehmen. Die Psychiatrie findet auf die veränderte Hörsituation keine rechte Antwort und neigt dazu, voreilig alle klanglichen Halluzinationen als Krankheitszeichen überzubewerten (wie Scharfetter kritisiert, Allgemeine Psychopathologie, 2002, S. 209). Es war wie ein unverstandenes Warnsignal, als Beethoven bereits im frühen Alter ertaubte. Schumann litt unter extremen akustischen Halluzinationen, bevor er in die Irrenanstalt eingeliefert und dort kein Weg zu seiner Heilung gefunden wurde.
Der Musikwissenschaftler Heinrich Schenker ist einem vollen Verständnis des Tons sehr nahe gekommen. Wenn es auch etwas umständlich ausgedrückt ist, kann ich ihm im Ganzen sehr gut folgen:
»Wir sind der Ansicht, daß man nicht eher sagen kann, die Töne gehört zu haben, als bis sie zu dem Bewußtsein, sozusagen bis in das Centrum derselben, vorgedrungen sind. So aufdringlich auch die Schallwellen, ihren Gesetzen gemäß, von selbst nun erscheinen mögen, so wollen dennoch die Töne nur gleichsam gastlich bewillkommnet in das Bewußtsein einziehen, und wenn das Bewußtsein sie nicht einlädt, nicht selbst die Initiative führt, so fehlt die lange, breite Wirkung, um die es sich doch hauptsächlich handelt, denn es fehlt den Tönen die Kraft, das Bewußtsein in solchem Maße zu provozieren, zu vergewaltigen, als es das Verständnis erheischt« (Schenker Das Hören in der Kunst (1894), in: Federhofer Heinrich Schenker als Essayist und Kritiker, S. 97).
Wechselwirkung und Zusammenhalt, Übergang zur Physik von Aristoteles
Der Begriff Tonos strebt in zwei Richtungen auseinander: Wechselwirkung und Zusammenhalt.
Wechselwirkung: Wird Spannung verstanden als die physikalische Wechselwirkung zwischen gegebenen, bestehenden Objekten, dann ist damit die Grundlage der atomistischen und neuzeitlichen Physik gefunden. Das ist der gemeinsame Nenner, auf den sich Atomisten, Philoponos, Leibniz, Newton und Einstein einigen lassen. Spannung ist eine Wechselbeziehung zwischen den kleinsten Bausteinen, den Atomen in einer leeren Welt. Mit dieser Einschränkung gehen zwar alle Zwischentöne verloren, die zusammenhaltende Kraft des Tonus, der Versuch, belebende bzw. lähmende Effekte zu erkennen, aber das ist der direkte Weg, sich ganz auf das zu konzentrieren, was gemessen, nachgewiesen und in die Form mathematischer Funktionen gebracht werden kann. Wenn die Welt ausschließlich aus Wechselbeziehungen dieser Art besteht, gibt es keinen Platz für Rhetorik, und auf den ersten Blick ist die Absicht von Aristoteles von seinen Gegnern verwirklicht worden.
Sicher gibt es verschiedene Interpretationen der Wechselwirkung: Newton ging vom absoluten, leeren Raum aus, in den die Objekte hineingestellt sind und durch den Wechselbeziehungen wie die Gravitation erfolgen. Leibniz war in gewisser Weise konsequenter: Wenn der Raum leer ist, kann der Raum als Idee aufgegeben werden. Da der leere Raum keine Eigenschaften hat, braucht ihn die Physik nicht und es genügt, eine Physik der Dinge und ihrer gegenseitigen Beziehungen zu formulieren. Aufgabe der Mathematik ist, dafür die geeigneten Ausdrücke und Methoden bereit zu stellen.
Einen wichtigen Schritt weiter ging Einstein. Wenn zwei räumlich voneinander entfernte Dinge in Wechselwirkung stehen, muss diese auch an jedem Punkt zwischen diesen Dingen spürbar sein. Wenn sich etwas zwischen diesen Dingen bewegt, gerät es in die Kraftwirkung der von diesen Dingen aufgebauten Spannung. Licht kann z.B. von Schwerefeldern abgelenkt werden. Daher ordnete er jedem Punkt im Raum einen Wert zu, der die Gesamtwirkung der auf diesen Punkt wirkenden Spannungen der umgebenden Dinge bezeichnet. Das nannte er die Krümmung des Raums an dieser Stelle. Dieser Ausdruck ist missverständlich. Denn nicht der Raum ist gekrümmt, sondern die vorliegenden Spannungen üben eine krümmende Wirkung auf alle Bewegungen aus, die diesen Punkt durchlaufen. Für die Rechnungen der mathematischen Physik ist ist es jedoch vereinfachend und nach heutigem Wisensstand im Resultat gleichbedeutend, mit Einstein von einem gekrümmten Raum auszugehen.
An zwei Punkten stößt die Physik der Wechselwirkungen an ihre Grenzen: Einstein setzt voraus, dass es immer möglich ist, dass sich dritte Dinge zwischen räumlich entfernten Dingen hindurch bewegen können. Es ist aber die Frage, ob nicht diese Eigenschaft des "Zwischen", letztlich des räumlichen, inneren Zusammenhangs seinerseits ein Begriff ist, der dem Raum zugrunde liegt. Das ist die Fragestellung, von der Aristoteles ausging, als er von Platon den Begriff metaxy (Zwischen, Inmitten) übernahm und fragte, welche Eigenschaften das Zwischen haben muss. Die wichtigste Eigenschaft ist sein innerer Zusammenhang.
Und die moderne Teilchenphysik stößt laufend auf Phänomene, die nicht aus den Wechselwirkungen der bekannten Teilchen erklärt werden können. Sie sieht sich daher gezwungen, zusätzliche virtuelle Teilchen zu postulieren, was zu der Frage führt, in welchem Raum sich die virtuellen Teilchen befinden und wie aus diesem Raum der übliche physikalische Raum erklärt werden kann.
Der Ansatz von Aristoteles ist jedoch nicht aus diesen Problemen der atomistischen Philosophie entstanden, sondern aus einer eigenen, ganz anderen Fragestellung. Aristoteles wollte zeigen, wie etwas Neues entstehen kann, das im vorgefundenen Gefüge der Wechselbeziehungen fehlt. Die wahre Kunst des Hörens besteht darin, auch das zu hören, was nicht zu hören ist, das Fehlende herauszuhören und dessen Ankunft zu erwarten und vorzubereiten. So geht jeder innovative Komponist vor, der etwas noch nicht zu Hörendes hört, aufschreibt und über die Aufführung seines Werkes zum Hören bringt. Obwohl dies viel stärker der Lehre des Christentums zu entsprechen scheint, hat sich mit der Dominanz des Christentums seit Philoponos der Ansatz von Aristoteles in der Physik nicht durchgesetzt. Er hatte den Anspruch, mit den Mitteln der Physik das Neue und das Vergehen erklären zu können, ohne auf religiöse Aussagen zurückgehen zu müssen. Ob das gelungen ist, wird eine weitere Frage sein und ebenso, ob seine Begriffe helfen, die Konstitution des hier nur intuitiv eingeführten Begriffes eines symbolischen Leibes zu leisten.
Einen Sonderfall stellt Nietzsche dar. Nirgends gebraucht er Ton im Sinne von Tonus oder Spannung. Meistens wird er missverstanden, als gäbe es nur die »erschütternde Gewalt des Tones« des Dionysischen. Seine Sehnsucht geht woanders hin: »Wie lieblich ist es, daß Worte und Töne da sind: sind nicht Worte und Töne Regenbogen und Schein-Brücken zwischen Ewig-Geschiedenem? ... Sind nicht den Dingen Namen und Töne geschenkt, daß der Mensch sich an den Dingen erquicke?« (Also sprach Zarathustra, "Der Genesende"). Töne haben zu tun mit dem Schützenden und Verbergenden, aus dem heraus sich das Leben der Natur entfalten kann. Darauf wird zurückzukommen sein, wenn Aristoteles' Verständnis der physis kommentiert wird. Dann wird sich zeigen, dass entgegen vieler anderslautender Urteile Nietzsche und Aristoteles in ihrer Kritik an der Rhetorik im Grunde gar nicht so weit voneinander entfernt sind.
2005 - 2009
Literaturhinweise
Aristoteles: Physik, in: Schriften Bd. 6, Hamburg 1995 ( Link )
Manuel DeLanda: Intensive Science and Virtual Philosophy, London, New York 2002
Gilles Deleuze: Logik des Sinns, Frankfurt am Main 1993 [1969]
Hellmut Federhofer: Heinrich Schenker als Essayist und Kritiker, Hildesheim 1990
Gerhard Fröhlich: Habitus und Hexis
in: Schwengel, H., Höpken, B. (Hg.): Grenzenlose Gesellschaft, Bd. II, Teil 2, S. 100-102, Pfaffenweiler 1999; Link
Thrasybulos Georgiades: Musik und Sprache, Berlin, Heidelberg 1974
Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache, Frankfurt am Main 1978
Johannes Philoponos: Ausgewählte Schriften, hg. von Walter Böhm, München u.a. 1967
Jürgen Uhde, Renate Wieland: Denken und Spielen, Kassel 1988
© tydecks.info 2011