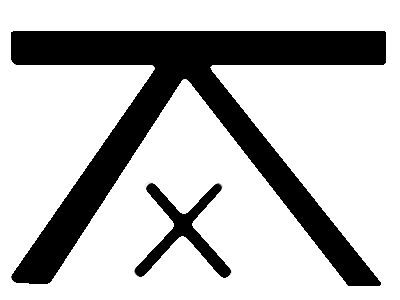Walter Tydecks
Kant und Gödel oder zur Freiheit der mathematischen Konstruktion
Vortrag beim 12. Internationalen Kant Kongress, Wien 21.-25. September 2015, erweitert mit einigen Ergänzungen und einer Fortführung zur transzendentalen Logik. Vortragsversion veröffentlicht in: Violetta L. Waibel, Margit Ruffing und David Wagner (Hg.): Natur und Freiheit. Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses. Berlin, New York (De Gruyter) 2018, Band 2, 1439-1448
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Relativität bei Kant
Zeitschleifen im Gödel-Universum
Mathematische Anschauung
Freiheit der mathematischen Konstruktion
Schlusswort
Fortführung: Logische Syntax der Sprache und transzendentale Logik
Einleitung
Bei einem Kant-Kongress in Wien sollte Kurt Gödel nicht fehlen. Gödel lebte 1906 bis 1978. Er kam aus Brünn, studierte in Wien, gehörte dem Wiener Kreis an und schrieb hier 1931 und 1938 seine bahnbrechenden Arbeiten über formal unentscheidbare Sätze und zur Kontinuum-Hypothese. 1940 musste er Österreich verlassen, als ihm nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland eine akademische Laufbahn verschlossen wurde. Er ging in die USA und lernte 1942 in Princeton den 27 Jahre älteren Albert Einstein näher kennen, mit dem er bis zu dessen Tod 1955 eng befreundet war.
Beide hatten schon im Alter von 16 Jahren die Kritik der reinen Vernunft von Kant gelesen und sich zeitlebens mit dessen Philosophie beschäftigt, auch wenn ihr philosophisches Vorbild sicher Leibniz war. In ihren gemeinsamen Gesprächen in Princeton ging es vor allem um Kant. Sie fanden bei Kant überraschende Übereinstimmungen mit der Relativitätstheorie und stellten die vorherrschende Meinung in Frage, Kant sei wie Newton ein Vertreter des absoluten Raums und der absoluten Zeit und durch die weitere Entwicklung der Naturwissenschaft widerlegt.
Abstract In diesem Beitrag sollen in drei Schritten die Gedanken von Gödel zu Kant dargestellt werden, um abschließend eine Schlussfolgerung über die von Kant gemeinte Freiheit der Konstruktion zu ziehen. (1) Die von Kant ausgeführte transzendentale Ästhetik von Raum und Zeit gilt nur relativ in Bezug auf solche vernunftbegabte Wesen, die mit der uns bekannten Sinnlichkeit ausgestattet sind. (2) Es ist daher möglich, auch eine Physik zu entwerfen, die diesen Zeitbegriff verlässt. Gödel demonstriert das mit einem eigenen Entwurf eines rotierenden Universums, in dem Zeitschleifen möglich sind und die uns bekannte Kausalität verletzt wird. (3) Wie Kant hält Gödel eine andere Art zu denken für möglich, die er in der mathematischen Anschauung erfüllt sieht. (4) Daraus ergibt sich für mich eine Freiheit der mathematischen Konstruktion, die ich in Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft angesprochen sehe.
1. Relativität bei Kant
Wer Übereinstimmungen zwischen der Philosophie von Kant und der Relativitätstheorie von Einstein nachweisen will, kann sich auf Kants Ausführungen beziehen, dass jeder Begriff »als der Standpunkt eines Zuschauers (anzusehen ist), (der) seinen Horizont hat, d.i. eine Menge von Dingen, die aus demselben können vorgestellet und gleichsam überschauet werden« (KrV, B 686). Kant bezeichnet die vom Begriff aus überschaubare Menge von Dingen als dessen »Sphäre«, die im Innern gekrümmt ist (KrV, B 672 und B 790).
Das kommt deutlich in die Nähe der Relativitätstheorie von Einstein, und es kann versucht werden, mithilfe der neueren Erkenntnisse der Naturwissenschaft genauer zu bestimmen, welche Eigenschaften diese Sphäre und ihre Krümmung haben. So ist bereits die Frage offen, ob hier von »Sphäre«, »Äther« »Medium« oder »nicht-euklidischer Mannigfaltigkeit« zu sprechen ist.
Doch Gödel ging einen anderen Weg. Um ihn zu verstehen, ist zu fragen, worin die Relativität des Standpunkts des jeweiligen Begriffs bei Kant bzw. des Beobachters bei Einstein ihren Grund hat, und ob Kant und Einstein auch hierin übereinstimmen. An Kant ist die Frage zu richten, wie es ihm möglich war, die Grenzen der Natursicht und Begriffsbildung zu überschauen, deren Begriffe innerhalb bestimmter Horizonte verbleiben, obwohl dies auch für ihn selbst und seinen eigenen Standort gelten müsste. Wie kann er sich sowohl innerhalb wie außerhalb einer solchen Weltsicht bewegen? Das ist nur möglich, wenn beide nur relativ gelten.
Das ist die Relativität, um die es Gödel geht. Damit ist nicht mehr die Relativität des Standorts eines einzelnen Beobachters gemeint, sondern die Relativität seiner Weltsicht im Ganzen. Gödel will zeigen, wie für Kant diese Art Begriffe zu bilden gebunden ist an die spezifische Sinnlichkeit, d.h. die dem Menschen zugehörigen Sinnesorgane, mit denen er die Natur wahrnimmt und aus den Wahrnehmungen Vorstellungen bildet. Gödel will zeigen, dass für Kant die transzendentale Ästhetik keineswegs einen absoluten Raum- und Zeitbegriff erzeugt, sondern im Gegenteil der Ausgangspunkt ist, von dem aus sich verschiedene Anschauungsmöglichkeiten entwickeln können, wie die Welt zu sehen ist. Der von Kant ausgeführte Raum- und Zeitbegriff gilt nur relativ in Bezug auf die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit und Einbildungskraft.
Von den verschiedenen Belegstellen, die Gödel bei Kant heranzieht, erscheinen mir die folgenden besonders überzeugend.
»Wenn aber ich selbst, oder ein ander Wesen mich, ohne diese Bedingung der Sinnlichkeit, anschauen könnte, so würden eben dieselben Bestimmungen, die wir uns jetzt als Veränderungen vorstellen, eine Erkenntnis geben, in welcher die Vorstellung der Zeit, mithin auch der Veränderung, gar nicht vorkäme« (Kant, KrV, B 54, zitiert bei Gödel 1995, S. 235 und 248).
Es gilt für Kant nur unter der »Bedingung der Sinnlichkeit«, dass wir uns alle Vorstellungen nur innerhalb von Raum und Zeit bilden können. Wären wir nicht an diese Sinnlichkeit gebunden, dann wären uns andere Vorstellungen möglich. Die Vernunft ist nur indirekt an die Sinnlichkeit gebunden und kann daher auf andere Weise den Raum aller Verstandesbegriffe überschauen und erkennen, dass er nicht euklidisch, sondern gekrümmt ist.
Kant führte diesen Gedanken in den Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können weiter aus.
»Diese Gegenstände sind nicht etwa Vorstellungen der Dinge, wie sie an sich selbst sind und wie sie der pure Verstand erkennen würde, sondern es sind sinnliche Anschauungen, d. i. Erscheinungen, deren Möglichkeit auf dem Verhältnisse gewisser an sich unbekannten Dinge zu etwas anderem, nämlich unserer Sinnlichkeit, beruht« (Kant, Prol. § 13, AA 04: 286.20-25, zitiert bei Gödel 1995, S. 231 Fn. 8 und S. 249 Fn. 11).
Mit der transzendentalen Ästhetik entwirft Kant keine absolut gültigen Ideen von Raum und Zeit, die für jede Naturwissenschaft gelten müssen, oder die mit den Dingen an sich identisch sind und die zu verfehlen daher einen Irrtum der Naturwissenschaft anzeigen würde, sondern er sagt lediglich, dass die Vorstellungen, die wir uns von den Dingen machen, nur relativ gelten bezüglich der uns gegebenen sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit.
Wie lässt sich das mit der Relativitätstheorie von Einstein vergleichen?
Da ist als erstes die Frage, welches Gegenstück die Relativität gegenüber einer bestimmten Sinnlichkeit bei Kant in der Relativitätstheorie von Einstein haben kann. Das Gegenstück kann nicht der einzelne Beobachter sein, der entsprechend seinem Bewegungszustand die Bewegungen anderer Objekte anders misst als diese selbst oder dritte Beobachter. Sondern das Gegenstück muss etwas sein, das in der Relativitätstheorie allen Beobachtern gemeinsam zugrunde liegt und erklärt, warum sie jeweils nur innerhalb eines bestimmten Horizonts und mit nur für ihren Standort gültigen Ergebnissen die Orte und Bewegungen anderer Objekte messen und die Regelmäßigkeiten der Messungen darstellen können.
»For Kant time (and space) exist only relative to the special structure of our organs of sense and imagination and the special manner of their being influenced by outer and inner objects, in relativity theorie however they exist relative to our body insofar as it is (irrespective of its structure) a kind of sense organ owing to the general laws of physical influence« (Gödel 1995, S. 426f).
So wie bei Kant die Anschauungsformen von Raum und Zeit gebunden sind an die spezifische Sinnlichkeit des Menschen, so ist in der Relativitätstheorie von Einstein die Relativität des Beobachtungshorizonts der einzelnen Beobachter daran gebunden, dass sie aufgrund ihrer Körperlichkeit in einer spezifischen Art und Weise den Einflüssen der anderen Objekte ausgesetzt sind und diese nur darüber wahrnehmen. Hätten sie keine Masse und befänden sich in einem Bewegungszustand wie das Licht, dann würde für sie die Welt anders aussehen. Es ist eine der verblüffendsten und dem Menschen am schwersten zugänglichen Erkenntnisse der Relativitätstheorie, dass das von Einstein nachgewiesene Zwillings-Paradoxon im Extrem – wenn der schneller bewegte Zwilling Lichtgeschwindigkeit erreicht – bedeutet, dass aus der Sicht des auf der Erde zurückbleibenden Zwillings der mit Lichtgeschwindigkeit reisende Zwilling überhaupt nicht mehr altert, also keine Erfahrung einer vergehenden Zeit macht. Diese Grenzgeschwindigkeit kann nach Einstein nur von Objekten erreicht werden, die wie das Licht die Ruhemasse Null haben. Und das bedeutet – worauf Gödel hinaus will – im Umkehrschluss, dass es die Masse (oder in anderen Ausdrucksweisen deren Trägheit oder Körperlichkeit) ist, weswegen ein Objekt in der von der Relativitätstheorie beschriebenen Art einen Ort einnimmt, von dem aus seine Messungen der anderen Objekte nur innerhalb eines begrenzten Vorwärtskegels gelten.
Von daher ergibt sich auch die Antwort auf die nächste Frage, ob die von der Relativitätstheorie gemeinte Zeit, die für leblose, physikalische Objekte gilt, vergleichbar ist mit der Sinnlichkeit eines lebenden, vernunftbegabten Wesens, welches Kant meint (Gödel 1995, S. 427).
Gödel antwortet mit zwei Argumenten. (1) Für ihn gibt es »a very natural generalization of 'sensibility', which belongs to lifeless objects as well«, das ist »the faculty of being physically influenced in the inner state by outer objects« (Gödel 1995, S. 427) Wenn der Bewegungszustand eines mechanischen Objekts durch ein anderes Objekt verändert werden kann, kann die Aufnahmefähigkeit für die Wirkung einer Kraft (sei dies ein mechanischer Stoß oder eine fernwirkende Anziehungskraft) verstanden werden als eine elementare Form von sinnlicher Wahrnehmung, die auch leblosen Objekten zueigen ist. (2) Und umgekehrt gehört auch zur Sinnlichkeit eines lebenden Wesens die Orientierungsfähigkeit, an welchem Ort es sich befindet (»being at a certain place«, Gödel 1995, S. 427).
Auch wenn die vom Menschen gebildeten Vorstellungen nur in Bezug auf die menschliche Sinnlichkeit zu verstehen sind, sind sie dennoch nicht unabhängig von den Dingen, die wahrgenommen werden. Kant betont, dass es etwas geben muss, das in den Dingen liegt, worauf sich die Erscheinungen beziehen. Gödel übernimmt diese Position. Einerseits gibt es aufgrund der Relativität keine eindeutige Beziehung zwischen der zeitlichen Ordnung im Bewußtsein und der Ordnung in den Dingen (die Erscheinungen sind keine mechanischen Abbilder), andererseits sind die Erscheinungen aber auch nicht völlig unabhängig von den Dingen (siehe hierzu z.B. Gödel 1995, S. 250)
2. Zeitschleifen im Gödel-Universum
Als Gödel verstanden hatte, dass es für Kant und Einstein eine übereinstimmende Relativität gibt, die tiefer liegt als in der Relativität des jeweils individuellen Standorts eines einzelnen denkenden Wesens oder physikalischen Objekts in der Raumzeit, suchte er nach Alternativen für anderen Raumzeiten, die mathematisch den von Einstein entwickelten Feldgleichungen für die Allgemeine Relativitätstheorie genügen, aber nicht dem von Einstein vorausgesetzten intuitivem Zeitbegriff. Indirekt zeigte er damit, dass Einstein implizit von dem Zeit-Begriff ausgegangen war, den Kant in der transzendentalen Ästhetik ausgeführt hatte.
Gödel überreichte Einstein als Geschenk für dessen 70. Geburtstag den mathematischen Entwurf eines rotierenden Universums (»R-world«), das allen Anforderungen der Allgemeinen Relativitätstheorie genügt, innerhalb dessen aber Zeitreisen (Zeitschleifen) möglich sind, wodurch die übliche Eindeutigkeit der Zeitrichtung von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft verletzt ist und daher auch nicht mehr der übliche Kausalitäts-Begriff gilt (Gödel An example of a new type of cosmological solutions of Einstein's field equations of gravitation, Gödel 1990, S. 190-198). Damit entfernte sich Gödel so weit von der Hauptströmung der Naturwissenschaft, dass er lange nicht ernst genommen und sogar ein – erfolgloser – Versuch präsentiert wurde, seinen Entwurf mathematisch zu widerlegen (siehe hierzu Yourgrau, S. 142).
In einem rotierenden Universum hat die Relativität der Standorte verschärfte Auswirkungen. Wenn für einen Beobachter ein Ereignis A dem Ereignis B vorausgeht, kann sich das für einen anderen Beobachter genau umgekehrt verhalten. Es ist nicht mehr möglich, von einem eindeutig bestimmbaren Zeitverlauf zu sprechen.
»These structural differences further imply that an objective lapse of time, such as is contained in the intuitive idea of time, is impossible in the R-worlds. [...] Hence summarizing the foregoing considerations one may say that what remains of time in the R-worlds as an objective reality, independent of an observer or other objects of reference, neither defines a linear ordering of the events, nor consists of a one-dimensional system of points, nor can have the character of 'passing by'« (Gödel 1995, S. 251).
Als es nicht gelungen war, Gödel einen Fehler nachzuweisen, aber auch die von Einstein entwickelten Feldgleichungen für eine Allgemeine Relativitätstheorie nicht aufgegeben werden sollten, sind zahlreiche Versuche unternommen worden, mit Zusatz-Bedingungen (consistency constraints) die drohenden Paradoxien einer Zeitreise zu vermeiden (siehe hierzu z.B. Smeenk, Wüthrich, S. 4-7).
Es bleibt die Frage, ob wir in einem rotierenden Universum leben, oder ob dies nur ein theoretisches Modell ist. Bis heute gibt es keinen Nachweis dafür. Im Nachlass von Gödel sind Rechnungen gefunden worden, mit denen er er anhand der »Winkelorientierung der Galaxien [...] herauszubekommen [versuchte], ob die wirkliche Welt, die wir bewohnen, ein rotierendes Gödel-Universum ist« (Yourgrau, S. 215).
3. Mathematische Anschauung
Aus der gemeinsamen Kant-Lektüre mit Einstein hatte sich für Gödel ergeben, dass die auf der euklidischen Geometrie basierende Anschauungsform nur relativ in Bezug auf die menschliche Sinnlichkeit gilt. Daher sind für ihn auch andere Anschauungsformen denkbar und gleichwertig. So schreibt er 1964 im Supplement zum Cantor-Aufsatz:
»Ich sehe keinen Grund, warum wir weniger Vertrauen in diese Art der Wahrnehmung – das heißt in die mathematische Anschauung – haben sollten als in die Sinneserfahrung, die uns dazu veranlasst, physikalische Theorien zu formulieren« (Gödel 1990, S. 268, zitiert und übersetzt bei Yourgrau, S. 121).
Die mathematische Anschauung im Sinne Gödels darf nicht verwechselt werden mit dem Verstand oder der Vernunft im Sinne von Kant. Sie kann auch nicht mit Kant als zweiter Stamm der Erkenntnis neben der Sinnlichkeit gesehen werden (KrV, B 29), und ist bestenfalls entfernt der intellektuellen Anschauung zu vergleichen (siehe z.B. KrV, B 307 und B 311). Kant verstand die intellektuelle Anschauung ausdrücklich als nicht-sinnliche Anschauung, während Gödel an eine Anschauung mit einer eigenen Art von Sinnlichkeit denkt, die sich unterscheidet von der dem Menschen gegebenen physischen Sinnlichkeit und ihrer Bindung an Raum und Zeit. In den 1953 - 1959 entstandenen Entwürfen Is mathematics syntax of language? fragt er, ob der Mensch »possess an additional sense that would show to us a second reality completely separated from space-time reality and moreover so regular that it could be described by a finite number of laws« (Gödel 1995, S. 353). In einer späteren Fassung heißt es noch deutlicher: »The similarity between mathematical intuition and a physical sense is very striking.« (Gödel 1995, S. 359)
Gödel verstand dies als Platonismus: So wie an den physisch wahrgenommenen Figuren die mathematischen Ideen des Kreises oder der Gerade zu sehen sind, sind auch weitergehend an physisch wahrnehmbaren Dingen deren mathematische Begriffe (concepts) zu erkennen. Gödel ging so weit, sie mit Platon als eigene mathematische Objekte zu verstehen, die unabhängig vom Menschen existieren. Im Supplement zum Cantor-Aufsatz von 1964 heißt es: »We form our ideas also of those objects on the basis of something else which is immediately given.« (Gödel 1990, S. 264) Dennoch sah Gödel durchaus die Schwächen seines Ansatzes. Er entsprach nicht seinem eigenen Anspruch an einer strengen Philosophie. Es blieb für ihn letztlich unsicher, wie der Status und die Erkennbarkeit der mathematischen Objekte zu verstehen sind (siehe den Brief von Gödel an Schilpp vom 3. Februar 1959, Gödel 2003, S. 244).
Dagegen sah Kant die intellektuelle Anschauung nur dem »negativem Verstande« zugänglich (KrV, B 307), und für ihn war der »Begriff einer unkörperlichen Natur bloß negativ« (KrV, B 827). In meinem Verständnis lässt sich die intellektuelle Anschauung im Sinne von Kant verstehen als Grenzfall der von Gödel gemeinten anderen möglichen Anschauungsarten, so wie sich die Lichtgeschwindigkeit und die Ruhemasse Null des Lichts verstehen lässt als Grenzfall von Systemen mit unterschiedlichen Graden der Trägheit. Kant hat mit dem »negativen Verstande« die Grenzsituation getroffen, um die es Gödel ging, und die für Gödel zugleich ein ungelöstes philosophisches Problem blieb.
4. Freiheit der mathematischen Konstruktion
Aus meiner Sicht kommt Kant der mathematischen Anschauung im Sinne von Gödel nahe, wenn er in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft die Freiheit der Konstruktion negativ bestimmt. Während die Philosophie der »Vernunfterkenntnis aus bloßen Begriffen« fähig ist, beruht die Mathematik »nur auf der Konstruktion der Begriffe« (MAN, AA 04: 469.23). Mit dem einschränkenden »nur« ist gemeint, dass die Mathematik ihre Gegenstände nicht frei aus sich selbst heraus schöpft, sondern von anderer Seite erhält. Dem widersprachen im 19. Jahrhundert Mathematiker wie Georg Cantor, doch Gödel teilte diese Ansicht von Kant, wenn er sich gegen Cantors Idee einer Freien Mathematik aussprach (siehe Gödel in der Gibbs-Vorlesung 1951, Gödel 1995, S. 314f).
Die Freiheit der Mathematik zeigt sich innerhalb der Konstruktion. Auch hier bleibt Kant bei einer negativen Bestimmung, doch wird mit ihr gesichert, dass er dieser Freiheit bewusst keine Grenzen setzt. Die Mathematik nimmt zum einen Begriffe auf, die von der empirischen Naturwissenschaft kommen, und zum anderen Begriffe der Metaphysik. Weder sie noch die Metaphysik können aus sich selbst heraus einen empirischen Begriff schaffen. Kein »Dasein« kann konstruiert werden (MAN, AA 04: 469.28). Beide sind angewiesen auf die »systematische Kunst, oder Experimentallehre«, von denen Kant als Beispiel die Chemie nennt, auch wenn er nicht für vorstellbar hielt, dass sie je eine Wissenschaft werden könne (MAN, AA 04: 471.05). Die Kunst der Experimentatoren liefert neue empirische Erkenntnisse. Als herausragende Beispiele lassen sich Galilei, Hooke (ohne den Newton nicht möglich gewesen wäre) und Faraday (auf den Maxwell aufbaute) nennen. Sie sind die ersten Ideengeber, mit denen eine neue Sicht auf die Natur und in ihr neue Erkenntnisse gewonnen werden. Ohne sie wären weder Naturlehre noch Mathematik möglich. Doch ihre Ergebnisse bleiben so lange zusammenhangslos wie es nicht gelingt, sie in eine mathematisch arbeitende Wissenschaft zu bringen.
Die Fähigkeit der Mathematik beginnt dort, wo es ihr gelingt, die neuen, unerwarteten Erkenntnisse der empirischen Wissenschaft zu verstehen und für sie eigene, angemessene Methoden zu entwickeln. Bisher ist die Mathematik immer von Grund auf verwandelt aus dem Prozess der wissenschaftlichen Durchdringung einer empirischen Wissenschaft hervorgegangen. Eins der wichtigsten Beispiele ist die Entwicklung der Funktionentheorie im frühen 19. Jahrhundert, die aus der Beschäftigung mit Fragen der Elektrizität, des Magnetismus und der Wärmelehre entstanden war.
Aus der anderen Richtung übernimmt die Mathematik Begriffe, die von der Metaphysik erkannt worden waren. Kant nennt die transzendentalen Prinzipien und solche empirischen Begriffe, für deren Erkenntnis »kein anderes empirisches Prinzip ... gebraucht wird« (MAN, AA 04: 470.03-04). Als Beispiel dient ihm der Begriff der Materie. Bei ihm zeigt sich exemplarisch, dass er eine philosophische Konstruktion »nicht zu leisten vermag« (MAN, AA 04: 525.21). Der Begriff der Materie bleibt offen. Die Mathematik übernimmt ihn in dieser unfertigen Gestalt und versucht dennoch, Regeln der Materie zu finden. Kant nennt als Beispiel die »Hydrodynamik« (MAN, AA 04: 528.21, mit der mathematisch allgemeine Eigenschaften der Materie erkannt und beschrieben werden).
Die Freiheit der mathematischen Konstruktion entfaltet sich zwischen den neuen, bisher unbekannten Begriffen der Empirie und den offenen Begriffen der Metaphysik. Die besondere Fähigkeit der Mathematik liegt in ihrem Vermögen, solche Fragen nicht nur aufgreifen und die unterschiedlichen Naturlehren in »eigentliche Wissenschaft« verwandeln zu können (MAN, AA 04: 470:14), sondern sich selbst in dieser Entwicklung völlig neu zu entwerfen.
An diesem Punkt treffen sich aus meiner Sicht Kant und Gödel. Gödel schreibt in der 3. Fassung des Syntax-Beitrags:
»For the main function of mathematics (as of most ouf our conceptual thinking) is exactly to bring the vast manifold of possible situations and particularities of the existent under control. Therefore a mathematics that would be as unmanageable as the material to which it is applied would be without point.« (Gödel 1995, S. 352)
Gödel war sich der grundsätzlichen Übereinstimmung mit Kant völlig bewusst. 1961 heißt es in The modern development of the foundations of mathematics in the ligth of philosophy:
»Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass dieses intuitive Erfassen immer neuer und von den früheren logisch unabhängiger Axiomen, welches zur Lösbarkeit aller Probleme selbst eines sehr eingeschränkten Gebiets nötig ist, prinzipiell mit der Kantschen Auffassung der Mathematik übereinstimmt.« (Gödel 1995, S. 384)
Und doch bleibt ein Unterschied. Gödel schränkt bei aller Zustimmung sein Urteil über Kant ein. Er sieht die Mathematik in einer Grenzfunktion. Es würde in einen logischen Widerspruch führen, wenn sie ihrerseits einer weiteren Wissenschaft zur Begründung bedarf. Daher war er von der objektiven Existenz und Erkennbarkeit der Mathematik überzeugt und wirft Kant dessen Subjektivismus vor, der für ihn darin besteht, dass Kant die Erkennbarkeit der Dinge an sich für nicht möglich hält, sondern grundsätzlich relativiert durch die jeweilige subjektive Erkenntnis.
Die Freiheit der mathematischen Konstruktion haben nicht nur Kant und Gödel gesehen, sondern auch Robert Musil, der im Wien der Zwischenkriegszeit aufmerksam mitverfolgte, was in der Mathematik vorging.
Schlusswort
Ihm sei das Schlusswort gegeben.
»Es läßt sich verstehen, daß ein Ingenieur in seiner Besonderheit aufgeht, statt in die Freiheit und Weite der Gedankenwelt zu münden, obgleich seine Maschinen bis an die Enden der Erde geliefert werden; denn er braucht ebensowenig fähig zu sein, das Kühne und Neue der Seele seiner Technik auf seine Privatseele zu übertragen, wie eine Maschine imstande ist, die ihr zugrunde liegenden Infinitesimalgleichungen auf sich selbst anzuwenden. Von der Mathematik aber läßt sich das nicht sagen; da ist die neue Denklehre selbst, der Geist selbst, liegen die Quellen der Zeit und der Ursprung einer ungeheuerlichen Umgestaltung« (Musil, S. 39).
Fortführung: Logische Syntax der Sprache und transzendentale Logik
I Themenstellung
Die Frage nach der Zeit soll fortgeführt werden mit der übergreifenden Frage nach der transzendentalen Logik. Ausgangspunkt sind zwei Arbeiten von Eckehart Köhler zu Ramsey and the Vienna Circle on Logicism (2004) sowie Gödel and Carnap (2014), auf den mich am Rande des Kant-Kongresses Michael Stöltzner aufmerksam gemacht hat. Carnap hatte 1934 mit Logische Syntax der Sprache einen Entwurf vorgelegt, der an die Stelle der transzendentalen Logik treten und diese im Prinzip auf ähnliche Weise relativieren kann, wie es Gödel und Einstein gegenüber der transzendentalen Ästhetik gelungen war. Gödel beschäftigte sich von 1953 bis 1959 im Anschluss an die Gespräche mit Einstein über Kant mit dem Buch von Carnap, an dem er früher selbst mitgearbeitet hatte, jedoch ohne zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen.
Ist die Relativierung der transzendentalen Ästhetik zu erweitern auf eine entsprechende Relativierung der transzendentalen Logik? Während Kant die gewöhnliche und transzendentale Logik einander gegenüberstellte und die transzendentale Logik der gewöhnlichen Logik vorausgehen sieht, entwirft Gödel die Idee einer im Prinzip unendlichen Reihe von Logikkalkülen. Für ihn gibt es nicht nur den von Kant betrachteten Logikkalkül – für Kant die gewöhnliche Logik –, der mit einer an der euklidischen Geometrie orientierten Ästhetik verbunden ist, sondern entsprechend der Relativierung der transzendentalen Ästhetik auch weitere Logikkalküle.
In der Reihe der Logikkalküle sind zwei Prinzipien (Anfangsgründe) zu bestimmen: Nach welchem Prinzip wird die Reihe entwickelt (aus welchem Anfangsgrund geht sie hervor), und nach welchem Prinzip wird aus ihr ein bestimmter Logikkalkül ausgewählt (aus welchem Anfangsgrund entscheiden wir uns für eine bestimmte Logik).
Um darauf eine Antwort zu finden, ist von jedem Logikkalkül sein Schema zu unterscheiden. Ausgehend von Kant wird das Schema einer Logik verstanden als die übergreifende Struktur, durch die die jeweilige Logik mit der ihr zugehörigen Ästhetik (Sinneswahrnehmung) übereinstimmt. Es soll gezeigt werden: Mit dem Schema wird ein Logikkalkül als ein mathematisches Objekt erkannt. Oder anders gesagt: Das Schema ist das Mathematische an einem Logikkalkül.
Mit diesem Ansatz wird Kants Verständnis der metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft auf die Logik erweitert. Aus der Freiheit der mathematischen Konstruktion innerhalb der Naturwissenschaften wird die Freiheit der mathematischen Konstruktion innerhalb der Logik. Dadurch wird ein allgemeineres Verständnis gewonnen, was mit Mathematisierung einer Wissenschaft gemeint ist: Nicht nur die Objekte der Wissenschaft werden in ihrer mathematischen Gestalt erkannt, sondern die Wissenschaft im Ganzen wird ihrerseits als ein Objekt verstanden, dessen mathematische Gestalt zu erkennen ist. In diesem Sinn wird Carnaps Projekt interpretiert, mit der logischen Syntax der Sprache die Philosophie umzuwandeln in eine Wissenschaftslogik, die ihre Wissenschaftlichkeit aus der Fähigkeit gewinnt, mathematisch operieren zu können. Jedoch wird mit Gödel das von Carnap formulierte Toleranzprinzip wieder eingeschränkt und nach einer Sprache gefragt, die der Sache der jeweiligen Sprache gerecht wird. Es genügt nicht, eine formal korrekte Syntax zu entwerfen, sondern sie muss in Übereinstimmung mit der Sache gebracht werden, die durch diese Sprache angemessen formuliert werden soll.
Diese Vorgehensweise kann als Verallgemeinerung der Intuition des französischen Mathematikers Galois verstanden werden, der 1832 nicht mehr nach der mathematischen Gestalt bestimmter Rechenaufgaben – etwa der Quadrierung des Kreises, der Dreiteilung der Winkel, der Lösung von Gleichungen mit mehr als 3 Unbekannten –, sondern der Gestalt der Lösungswege dieser Rechenaufgaben gefragt hat. Das hat zu einer völligen Umwandlung der Mathematik geführt, und die Arbeiten von Frege und der ihm folgenden Logiker verstehe ich in diesem Kontext.
II Zwei unterschiedliche Bedeutungen der transzendentalen Logik bei Kant
Für Kant ist die transzendentale Logik durch das transzendentale Schema eng mit der transzendentalen Ästhetik verbunden (KrV, B 177f). In aller Deutlichkeit führt er die Schemate auf die Zeit zurück:
»Die Schemate sind daher nichts als Zeitbestimmungen a priori nach Regeln, und diese gehen, nach der Ordnung der Kategorien, auf die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die Zeitordnung, endlich den Zeitinbegriff in Ansehung aller möglichen Gegenstände.« (KrV, B 184f)
Mit dieser weitreichenden Aussage hat Kant nicht weniger gesagt, als dass die Urteilstafel auf die Zeit zurückgeführt werden kann, wenn die Zeitreihe mit der Quantität, der Zeitinhalt mit der Qualität, die Zeitordnung mit der Relation und der Zeitinbegriff mit der Modalität korrelieren. Was aber geschieht, wenn die transzendentale Ästhetik relativiert wird und es eine Erkenntnis gibt, für welche »die Vorstellung der Zeit, mithin auch der Veränderung, gar nicht vorkäme« (KrV, B 54)? Dann müssen offensichtlich auch das transzendentale Schema und die unter dieses Schema gebrachte transzendentale Logik relativiert werden. Daraus ergeben sich einige Fragen: Gibt es so viele Logiken, wie es Ästhetiken gibt? Sind die Logiken also nach den ihnen korrespondierenden Ästhetiken zu unterscheiden, oder lässt sich innerhalb der Vielfalt der Logiken ein eigenes unterscheidendes Prinzip erkennen? Kant hat versucht, mit dem transzendentalen Schema eine gemeinsame Struktur der transzendentalen Ästhetik und Logik zu finden und die Logik »im Horizont der Zeit« gesehen (Picht 1999, S. 5). Kann das verallgemeinert werden, das heißt, gibt es für jede Logik ein zugehöriges Schema, das ihren Horizont bestimmt? Dann hat nicht nur jeder Begriff – wie Kant gesagt hat – seine Sphäre, sondern auch jede Logik.
Aber die Frage nach einem Schema einer jeden Logik ist allgemeiner. Für mich ist denkbar, die Intuition, mithilfe derer Kant das transzendentale Schema aufzustellen vermochte, mit der von Gödel gemeinten mathematischen Anschauung zu vergleichen. Mit dem Schema werden an einer beliebig abstrakten Sache deren Formen für sich untersucht. Als mathematische Anschauung kann in diesem Sinne die Fähigkeit verstanden werden, an einer gegebenen Form das ihr Eigentümliche zu erkennen. Das hat Platon beispielhaft an den Ideen des Kreises oder der Zahlen ausgeführt. Wenn zum Beispiel ein Ring Kreis-Form hat, dann kann mithilfe der mathematischen Anschauung die Kreisgestalt vom Ring abgelöst und für sich betrachtet werden. Ihre mathematischen Eigenschaften gelten für alle Kreise, und nicht nur für den Ring, sondern auch für den kreisförmigen Umlauf der Sterne, den Querschnitt eines Baumstammes usf. Aristoteles hatte daher für diese beiden Schritte unterschiedliche Begriffe geprägt: In seiner Physik unterscheidet er von der morphe das schema. Erst das schema ist die mathematische Gestalt. Damit ist es ihm gelungen, die Bildung mathematischer Schemata und philosophischer Ideen (idéa) voneinander zu differenzieren, die bei Platon gemischt sind. Das hat nach meiner Überzeugung sowohl für die Mathematik wie für die Philosophie eine befreiende Wirkung (siehe Aristoteles Physik II.2, 193b-194a und hierzu den Beitrag Prinzipien einer Meta-Mathematik nach Aristoteles). Gödel hatte sich zwar aus noch zu erläuternden Gründen gegen die Philosophie von Aristoteles entschieden und sich in die Tradition von Platon gestellt, aber inhaltlich ging es ihm darum, wie Aristoteles für alle Objekte nach deren Schema zu fragen.
Der Ausdruck ‘Transzendentallogik’ und entsprechend ‘transzendentales Schema’ bekommt damit allerdings zwei unterschiedliche Bedeutungen und droht missverständlich zu werden. Er meint zum einen die von Kant in der Kritik der reinen Vernunft entwickelte transzendentale Logik, die an die von ihm gewählten Zeitbestimmungen gebunden ist, und er meint zum anderen das Vernunftprinzip, für eine jede Logik zu erkennen, welche transzendentalen Regeln implizit vorausgesetzt sind, die sich aus der jeweiligen Ästhetik ergeben. Nach meinem Eindruck ist bei Kant beides miteinander vermischt. Was er zum Schema schreibt, gilt teilweise allgemein für alle Logikkalküle und teilweise nur für solche, die innerhalb des Horizonts der Zeit stehen. Beides ist bei ihm nicht klar getrennt.
Diese Vermischung hat einen tiefen Grund in Kants Verständnis des Gemüts. Es ist von Kant einerseits so allgemein gefasst, dass es auch für andere vernunftbegabte Wesen gelten kann, die sich vom Menschen unterscheiden, andererseits aber spricht Kant von »unsrem Gemüt« und meint damit zweifellos das Gemüt des Menschen. Für ihn ist sowohl der äußere Sinn eine »Eigenschaft unsres Gemüts« (KrV, B 37), wie auch die Form der Anschauung verstanden wird als »die Art, wie das Gemüt durch eigene Tätigkeit, nämlich dieses Setzen ihrer Vorstellung, mithin durch sich selbst affiziert wird« KrV, B 67), und schließlich wird eine »Überlegung (reflexio)« als »Zustand des Gemüts« gesehen (KrV, B 316). Kant spricht hier ausdrücklich vom Gemüt und nicht vom Menschen, wodurch nahegelegt wird, dass er sich auf einer allgemeineren Ebene bewegt. Er versteht das Gemüt in einer ähnlich umfassenden Bedeutung wie Aristoteles in seiner Schrift Peri psychês (De Anima, Von der Seele).
Doch wird bei Kant bisweilen in der Schwebe gehalten, auf welcher Ebene er jeweils philosophiert: mit Blick auf alle vernunftbegabten Wesen oder auf den Menschen. Er lässt dann im Ungewissen, ob er im Horizont des Menschen oder der Vernunft im Ganzen, im Horizont der Zeit oder der Philosophie denkt. Statt den Horizont und das jeweilige Schema zu relativieren, begibt er sich in eine Art Zwischenzustand. Das ist ohne Frage im Verlaufe einer neuen Erkenntnis ein notwendiges Durchgangsstadium und zeugt davon, dass das Werk der Erkenntnis noch im Fluss und daher in seinem Gelingen gefährdet ist.
Zwar scheint bei Kant bisweilen die Idee von anderen vernunftbegabten Wesen auf, doch will er offenbar folgendem Widerspruch aus dem Weg gehen: Wenn der Mensch über eine Logik anderer vernunftbegabter Wesen nachdenkt, dann kann er dies einerseits nur innerhalb seines Horizonts denken, und will andererseits diesen Horizont verlassen und auch die Logik anderer Wesen verstehen. Darin sehe ich die von ihm gemeinte kopernikanische Wende: Der Mensch versteht die Welt nicht mehr von seinem Standpunkt aus, sondern versucht sich selbst aus der Perspektive eines übergreifenden Horizonts zu verstehen. Aber wie ist das möglich? Es muss entweder ausgelöst sein durch eine von außen kommende und dennoch dem Menschen verständliche Offenbarung, oder das menschliche Gemüt verfügt über zusätzliche Fähigkeiten, durch die es der Teilhabe an einer höheren Vernunft fähig ist. Das scheint mir die Ansicht von Gödel zu sein, wenn er sich auf den Platonismus beruft. Doch will Kant das vermeiden und gewinnt nach seiner eigenen Überzeugung erst dann sicheren Boden, wenn er nicht vorgibt, den eigenen Horizont verlassen, sondern einen größeren Horizont nur ex negativo denken zu können. Diese Schlussfolgerung will wiederum Gödel vermeiden. (Siehe zu diesen Fragen die für mich bahnbrechenden Arbeiten von Picht.)
Gödel hat diese Vermischung gesehen, aber noch nicht abschließend analysieren und kritisieren können. So verstehe ich sein Urteil über Kant von 1961: »Ich glaube, es ist eine allgemeine Eigenschaft vieler Kantscher Behauptungen, daß sie wörtlich verstanden falsch sind, aber in einem allgemeineren Sinn tiefe Wahrheiten enthalten.« (Gödel 1995, S. 384) Sie sind dann falsch, wenn unmerklich zwischen Aussagen über den Menschen und über alle vernunftbegabten Wesen gewechselt wird, und sie enthalten insofern Wahrheiten, wenn es gelingt, ihre Aussagen entsprechend zu differenzieren: (1) Die für den Menschen geltende transzendentale Logik im Horizont der Zeit. (2) Die für andere vernunftbegabte Wesen geltenden transzendentalen Logiken entsprechend deren Sinnlichkeit. (3) Die Frage nach einer übergreifenden Logik, von der aus alle Logiken zu übersehen sind, die nach Kant vom Menschen nur negativ zu bestimmen ist.
III Gotthard Günther
Der Philosoph und Mathematiker Gotthard Günther (1900-1984) hatte bereits 1940-41 in einer seiner frühesten Arbeiten Fragen dieser Art gestellt (Logistik und Transzendentallogik) und war damit bei Gödel auf großes Interesse gestoßen (siehe die Briefe von Gödel an Günther vom 30.6.1954 und 4.4.1957, Gödel 2003a, S. 502, 504, 526), auch wenn Gödel im Weiteren von Günthers Ideen in Richtung einer mehrwertigen Logik nicht überzeugt war und ihr Briefwechsel wieder einschlief. Günther hatte die Konsequenzen der Gödelschen Erkenntnisse für die Leibnizlogik auf den Punkt gebracht:
»Erst der gödelsche Satz sichert ihr die Möglichkeit unbegrenzter sachlicher Bereicherung und schrankenloser Verallgemeinerung. Andererseits aber weist dieser Satz auf die zwingende Notwendigkeit hin, die Leibnizlogik durch eine reine Transzendentallogik zu ergänzen.« (Günther, S. 19)
Für Günther stellte sich die Frage, »in welchem logischen Raum die Verallgemeinerungsreihe der Kalkülsysteme als rational-verbindliche Entwicklung des reinen Begriffs erscheint« (Günther, S. 22). Das hatte Gödel in seinem Brief vom 4.4.1957 positiv aufgenommen und als Frage nach der »Totalreflexion als etwas über alle Typenbildung hinausgehendes« formuliert.
Anders als Kant ist Gödel von der Existenz einer Vielzahl von Logikkalkülen überzeugt. Das ergibt sich für ihn aus seinen Unvollständigkeitssätzen. Kein Logikkalkül mit einem hinreichend aussagekräftigen Inhalt ist abgeschlossen. Die Idee einer Vielzahl von Logikkalkülen sah er dagegen bei Leibniz, und daher spricht Günther ausdrücklich von Leibnizkalkülen, um den Unterschied zu Kant hervorzuheben. Und dennoch stellt sich mit Kant sowohl die Aufgabe, für jede einzelne dieser Logiken ihr Schema zu erkennen, wie auch übergreifend zu fragen, ob dieser Vielzahl von Kalkülen eine gemeinsame transzendentale Logik zugrunde liegt und dem von Günther genannten »logischen Raum« aller Kalkülsysteme eine transzendentale Ästhetik vorausgeht.
IV Carnap
An dieser Stelle ist die Logische Syntax der Sprache von Carnap heranzuziehen, an der Gödel um 1932 mitgearbeitet hatte, auch wenn er deren Zielrichtung nur bedingt teilte. Köhler sieht in dieser Schrift den erfolgreichen Durchbruch des Logizismus (Köhler 2014, S, 114), wobei in diesem Zusammenhang Logizismus und Logistik gleichzusetzen sind. Mit der Unterscheidung der logischen Syntax von den Inhalten der Sprache, die in dieser Syntax ausgedrückt werden, hat Carnap Kants grundsätzliche Frage nach der transzendentalen Logik aufgenommen und aus dem Kontext gelöst, in dem sie bei Kant an dessen Raum- und Zeitbegriff gebunden war. Aus seiner eigenen Sicht ist er den Weg von Kant konsequent zu Ende gegangen, wodurch die Metaphysik und die traditionelle Philosophie abgelöst werden können. Die Fragen, die Kant sich stellte, werden für ihn übergreifend durch die Syntax beantwortet. Programmatisch schreibt er im Vorwort:
»Philosophie wird durch Wissenschaftslogik [...] ersetzt. Wissenschaftslogik ist nichts anderes als logische Syntax der Wissenschaftssprache.« (Carnap, S. IIIf)
Mit diesem Ansatz lassen sich für ihn die großen Fragen der Philosophie der Mathematik lösen. Für ihn klären sich auf diesem Weg sowohl der Begriff des Kontinuums wie auch die Russellsche Antinomie, wenn klar getrennt wird, in welcher Syntax diese Fragen gestellt und mit welchen Inhalten sie ausgeführt werden. Die Antinomien von Zenon, Kant und Russell gehen für ihn darauf zurück, dass unzulässigerweise Syntax und Inhalt gemischt wurden. Das ist für ihn weit grundlegender als die Unterscheidung von Objektsprache und Metasprache, die in der Typentheorie von Russell in die unendliche Progression fortlaufend neuer Metasprachen geführt hatte. Das gilt auch für die Begriffe von Raum und Zeit.
»Wir haben gesehen, daß die Frage nach der Struktur von Zeit und Raum die Syntax der Zeit- und Raumkoordinaten betrifft. Das Kausalproblem betrifft die syntaktische Form der Gesetze. [...] Die Frage der logischen Grundlagen der physikalischen Messung ist die Frage nach der syntaktischen Form der quantitativen physikalischen Sätze und nach den Ableitungsbeziehungen zwischen diesen Sätzen und den nicht-quantitativen Sätzen (z.B. Sätzen über Zeigerkoinzidenzen).« (Carnap, S. 251)
Für mich ist unverkennbar, wie Carnap Kants Ausführungen über das transzendentale Schema aufgreift und erweitert. Die Syntax übernimmt die Rolle der transzendentalen Logik, aber sie ist nicht mehr wie bei Kant auf eine starre a priori gegebene Begrifflichkeit festgelegt, sondern erlaubt eine Vielzahl von Sprachen mit ihrer jeweils eigenen Syntax. Er gibt Kant in der Unterscheidung unterschiedlicher logischer Ebenen recht, beschränkt diese aber nicht mehr wie Kant auf die gewöhnliche und die transzendentale Logik. Wenn Gödel mit Einstein nach einer inhaltlich bestimmten Relativierung des Zeit- und Raumbegriffs fragte, geht Carnap wesentlich weiter und lässt alle Theorien über Raum und Zeit zu, sofern sie syntaktisch korrekt ausgewiesen sind. Das ist die Konsequenz seines Toleranzprinzips. Seine einzige Bedingung an die Wissenschaftler lautet: »Nur muß er, wenn er mit uns diskutieren will, deutlich angeben, wie er es machen will, syntaktische Bestimmungen geben anstatt philosophischer Erörterungen.« (Carnap, S. 45)
Gödel nahm diesem Ansatz gegenüber eine differenzierte Haltung ein. Ich gehe davon aus, dass er Carnaps Kritik an Vermischungen von Syntax und Inhalt teilte, und dass er mit Carnap die Weiterentwicklung fortlaufend höherer Sprachen vertrat. Das ergibt sich aus seinen Unvollständigkeits-Sätzen und wurde von ihm beispielhaft in dem 1941 entstandenen Dialectica-Paper Über eine bisher noch nicht benützte Erweiterung des finiten Standpunktes ausgeführt. Aus diesem Grund konnte er Günther zustimmen, wenn der als die Konsequenz seines Satzes ausführt, die »Leibnizlogik (ist) die infinite Verallgemeinerung der klassischen Logik, weil sie äquivalent ist der (abzählbar) unendlichen Reihe aller logischen Theorien, deren Allgemeinheitsgrad jederzeit überbietbar ist« (Günther, S. 20). Er sah, wie sich aus seinen eigenen Unvollständigkeits-Sätzen eine Vielfalt von Logiken ergibt, und er war mit Carnap über Günther hinausgehend der Ansicht, dass sich dies bis in eine Vielfalt sprachlicher Entwürfe mit jeweils eigener Syntax fortsetzen muss. Diese Möglichkeit hatte Carnap mit seinem Toleranzprinzip eröffnet.
Aber die Beliebigkeit des Toleranzprinzips ging ihm zu weit. Stattdessen war er überzeugt, dass es eigenständige mathematische Objekte gibt, die eine eindeutige Struktur haben und keineswegs beliebig formuliert werden können. Für ihn handelt die Mathematik von einer Sache, und es muss möglich sein, an der Sache selbst zu erkennen, in welcher Sprache mit welcher Syntax sie sich angemessen darstellen lässt, statt in einer frei wählbaren Syntax über sie zu sprechen. Die Überzeugung, dass es eine solche Sache gibt, versteht Gödel als Platonismus. (Ich vermute, dass er Aristoteles als Subjektivisten gesehen hat, weil er Lehren der Psyche im wesentlichen in subjektivistischen Kontexten kannte und nicht gesehen hat, in welcher Weise Aristoteles darüber hinausgegangen ist. Es ist nur daran zu erinnern, dass Aristoteles seine Lehre des nous, »das Vermögen zu erkennen, was wahr ist«, wie Picht übersetzt, innerhalb seiner Schrift über die Seele entwickelt hat. Siehe Picht 1992, S. 372)
Für Gödel gilt beides: Es gehört sowohl zur Sache, dass von einer Vielfalt möglicher Sprachen und ihrer jeweiligen Syntax gesprochen werden kann, wie auch, dass aus ihnen eine bestimmte als adäquat ausgezeichnet ist. Daher ist nach zwei Prinzipien zu fragen: Nach welchem Prinzip entsteht die Vielfalt der Sprachen, und mit welchem Prinzip wird aus dieser Vielfalt diejenige ausgewählt, die sachgemäß ist. Diese Frage ähnelt dem Ansatz von Leibniz. Er vertrat die Vielfalt aller möglichen Welten und das Harmonie-Prinzip, mit dem aus der Vielfalt aller Welten die bestmögliche Welt ausgewählt und wirklich wurde (siehe hierzu van Atten Monads and sets).
Gödel hat sich damit in seinem Gibbs-Vortrag von 1951 beschäftigt und sie am Beispiel der Frage ‘Was ist analytisch?’ exemplarisch angegangen. Dort hat er ausgehend von Carnap den Begriff ‘analytisch’ relativiert. Was analytisch ist, gilt nur relativ innerhalb der jeweils gegebenen Sprache und ihrer Syntax. Gödel entwirft daher die Idee einer stufenweisen Entwicklung neuer Sprachen, wobei in den höheren Sprachen als tautologisch (analytisch) erscheint, was in den unteren Sprachen offen war und bewiesen werden mußte. Im Ergebnis können mit Ramsay in einer höheren Sprache selbst das Auswahlaxiom und das Axiom der Unendlichkeit bloße Tautologien sein (siehe hierzu Köhler 2004). Dieser Aufbau von Sprachen ähnelt jedoch der Typentheorie von Russell und kann mit dem gleichen Argument kritisiert werden. Es genügt nicht, fortlaufend neue Sprachen zu entwickeln, sondern es ist zu fragen, nach welchem inneren Prinzip dieser Aufbau erfolgt.
Auf analoge Weise lässt sich auch relativieren, was mit ’a priori’ gemeint ist. Was in einer Sprache a priori gilt, kann aus Sicht einer anderen Sprache hergeleitet werden. Die Missverständlichkeit der Kantschen Philosophie lässt sich besonders deutlich an seinem Gebrauch des Ausdrucks ‘a priori’ zeigen. Nur innerhalb einer bestimmten Logik gilt etwas als a priori, und wird im Schema dieser Logik behandelt. Das hat Kant jedoch nicht mehr relativiert, sondern nahegelegt, dass alles das, was innerhalb »unseres Gemüts« a priori gilt, auch übergreifend a priori gelten muss. Daher kritisiert Köhler Kant »for his magical pure intuition (reine Anschauung), a highly idealized faculty of infinite power. This Kant had inferred (out of a magician's hat, so to speak).« (Köhler 2014, Typoskript einer erweiterten Version, S. 2).
V Negative und transfinite Typen
Gödel sah sich nicht in der Lage, für diese Frage eine für ihn befriedigende Antwort zu finden (siehe seinen Brief an Schilpp vom 3. Feb. 1959, Gödel 2003b, S. 224). Während Kant die transzendentale Logik für unveränderlich (a priori) und damit starr und nicht-relativierbar sieht, und Gödel hier offener ist, ist umgekehrt betreffend der Grenzfragen Kant offener, wenn er dort regulative Ideen ansetzt, wo Gödel ein mathematisches Objekt sieht, das wie ein Ding an sich unveränderlich ist. Beide kämen dann zusammen, wenn auf der einen Seite Kant die Erkenntnis der transzendentalen Logik in ähnlicher Weise relativiert wie die transzendentale Ästhetik (jedenfalls in der Deutung durch Gödel und Einstein) und eine Mehrstufigkeit zulässt, wo er in der Kritik der reinen Vernunft nur eine Zweistufigkeit von gewöhnlicher und transzendentaler Logik einräumt, wenn also der transzendentale Ort erweitert wird und dort nicht nur zwei Alternativen zur Unterscheidung bereit stehen, und wenn auf der anderen Seite Gödel die mathematischen Objekte in ähnlicher Weise nur negativ bestimmt, wie Kant das Ding an sich als nicht erkennbares Noumenon bestimmt hat (KrV, B 306f). Es muss zwar in übertragenem Sinn ein »mathematisches Objekt an sich« geben, das dem Kantschen Ding an sich entspricht, aber der Mensch kann davon immer nur entsprechend seiner »sinnlichen Anschauung« (KrV, B 307) bestimmte Seiten erkennen und fortlaufend vertiefen. Während Gödel auf der einen Seite mit Einstein die Relativierung des Zeitbegriffs hervorhebt, hat er an anderer Stelle Kant dort Subjektivismus vorgehalten, wo dieser die menschliche Erkenntnis von Dingen an sich und die Ideen der Vernunft relativiert und sie auf regulative Ideen einschränkt. Nur in dem genannten Brief an Günther ist deutlich das Anliegen von Gödel zu erkennen, an dieser Stelle seine Philosophie zu öffnen.
Im Ergebnis hatte Gödel das Gefühl, mit dem Carnap-Aufsatz in eine Sackgasse geraten zu sein. Nachdem auch von Günther keine für ihn befriedigenden Antworten zu bekommen waren, wandte er sich in den 1960ern der Philosophie von Husserl zu, und »kämpfte jahrelang darum, den Nebel von Husserls irritierenden Schreibstil zu durchdringen« und blieb am Ende nur bedingt überzeugt zurück (so Yourgrau, S. 199 mit Bezug auf die von Gödel mit Hao Wang in den 1970ern geführten Gespräche).
Wenn ich es richtig verstehe, will er mithilfe des transzendentalen Idealismus von Husserl das Programm von Carnap in anderer Weise fortführen. Es soll wie bei Leibniz und Carnap Vielheiten geben, aber anders als bei Carnap sollen diese an der Sache orientiert bleiben. Es sollen die wirklichen Gedanken aus der Gesamtheit aller noch unklaren, verworrenen, möglichen Gedanken abgeleitet werden und die Erkenntnis eines Objekts aus der Gesamtheit aller seiner Gegebenheiten, wobei diese wiederum zu verstehen sind als die Gesamtheit der mit dem Objekt gegebenen Möglichkeiten, ein solches Objekt wahrzunehmen (siehe hierzu van Atten, Kennedy, S. 461f).
Die Intentionen des erkennenden Subjekts spannen einen Erwartungsraum auf, den Möglichkeitsraum, was das Subjekt vom Objekt erwartet, worauf es seine Aufmerksamkeit lenkt und eine Lösung sucht. Dieser intendierte Erwartungsraum scheint mir formal dem Möglichkeitsraum der Welten bei Leibniz zu entsprechen.
Dem entspricht auf Seiten des Objekts ein Raum der Gegebenheiten. Mit den Gegebenheiten ist die Gesamtheit aller Weisen gemeint, wie sich ein Objekt präsentiert (oder auch verbirgt) und so auf unterschiedlichste Weise sowohl die Aufmerksamkeit hervorruft als auch sich ihr entzieht. Mit der Vielheit der Intentionen und der Gegebenheiten hat meines Erachtens Husserl gegenüber Kant den erforderlichen Rahmen gefunden, um die transzendentale Logik relativieren zu können. Mit Heidegger kann innerhalb dieser Vielheit unter Wahrheit das Aufleuchten verstanden werden, wenn es im Erkenntnisprozess funkt und sowohl das Objekt spürt, dass sein Wunsch sich zu zeigen verstanden wird, wie auch das erkennende Subjekt eine Wandlung (Erleuchtung) durchmacht, an der es existenziell erkennt, dass sich die Wahrheit gezeigt hat. Die Erleuchtung oder mit Fragment 64 von Heraklit der Blitz (keraunos) ist in allgemeinster Formulierung das gesuchte zweite Prinzip, wie aus dem Raum der Möglichkeiten eine Auswahl hervorgeht.
Mir erscheint es naheliegend, mit Köhler nach einer Erweiterung der Typenlehre um negative und transfinite Typen zu suchen (Köhler 2004, S. 114). Mit negativen Typen ist nach meinem Verständnis gemeint, dass die uns bekannten Ausdrücke nullter Stufe, das sind die gewöhnlichen Worte und Zahlen, die Objekte der Objektsprache, nicht nur mit der Prädikatenlogik erster Stufe in Aussagesätze gebracht und diese wiederum mit Prädikatenlogiken höherer Stufe analysiert werden können, sondern ihrerseits hervorgegangen sind aus einem Möglichkeitsraum, der sowohl durch die Gesamtheit der Intentionen wie der Gegebenheiten bestimmt ist. Jedes Wort und jede Zahl sind das Ergebnis einer vorausgegangenen Auswahl unterschiedlicher Möglichkeiten, und wenn diese für sich bestimmt werden sollen, ist von negativen Stufen zu sprechen. Sie gehen in einem Möglichkeitsraum den Objekten der nullten Stufe voraus, wie sie im gewöhnlichen Denken gebraucht werden.
Das ist auch eine Antwort auf das zu Frege viel diskutierte Paradox, warum er gegenüber den beiden Eigennamen “Abendstern” und “Morgenstern” den dritten Eigennamen “Venus” als ihre gemeinsame Bedeutung auszeichnet. Die Mannigfaltigkeit der von Frege gemeinten Eigennamen verstehe ich als einen Raum unterschiedlicher Möglichkeiten, etwas zu benennen, und nach einem noch unbekannten Prinzip wird daraus ein Eigenname ausgewählt und als Bedeutung gesetzt. Inhaltlich legt Freges Beispiel nahe, dass er die astronomische Forschung, in der der Eigenname “Venus” gebraucht wird, für das Entscheidungskriterium ansieht gegenüber Alltagsausdrücken wie “Abendstern” und “Morgenstern”. Aber es wäre klar zu benennen, wann von anerkannter Wissenschaft und wann von bloßer Alltäglichkeit zu sprechen ist (siehe hierzu Köhler über die Frage nach den Werten, mit denen diese Entscheidung getroffen wird, Köhler 2014). Mir geht es an dieser Stelle vor allem darum zu zeigen, dass die von Frege genannten Bedeutungs-Träger als Objekte nullter Ordnung verstanden werden können, auf die sich die elementaren Aussagen erster Ordnung beziehen, während die Sinn-Träger einem vorausgehenden Möglichkeitsraum mit negativer Ordnung angehören.
Ein solcher Ansatz nimmt erkennbar Kants Frage nach einer transzendentalen Logik auf, die der gewöhnlichen Logik vorausgeht, und erweitert sie. Es ist zunächst offen, ob es für die negativen Typen in ähnlicher Weise gelingt, eine weitere und potentiell unendliche Mehrstufigkeit aufzubauen, wie es Cantor mit den transfiniten und Kardinal-Zahlen gelungen ist. Und vor allem stellt sich hier die grundsätzliche Frage, den Begriff der negativen Zahlen zu erweitern, siehe dazu im Folgenden eine der offenen Fragen.
Auf der anderen Seite ist die Frage zu stellen, ob im positiven Bereich transfinite Typen möglich sind. Das bedeutet, dass es auch in der Reihe der Logikkalküle und sogar der Sprachen einen Sprung gibt in Analogie zum Sprung von den natürlichen zu den reellen Zahlen. Es würde bedeuten, dass begrifflich und logisch neue Ganzheiten (vergleichbar den reellen Zahlen) gebildet werden können, die nicht zurückführbar sind auf einzelne Elemente. (Siehe die Argumentation von Leibniz zu den unendlichen Mengen, und in Kritik daran van Atten. Gödel hat das Argument von Leibniz mit dem Reflexionsprinzip formalisieren und rechtfertigen wollen. Anders als van Atten scheint mir Gödel recht zu haben, doch soll das an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.)
VI Offene Fragen
Abschließend sollen Themen genannt werden, die offen geblieben sind:
(+) Negativität: Kants Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen ist neu aufzunehmen. Es war eine großartige Idee, die Negativität nach dem Vorbild von Soll und Haben oder den beiden Hälften einer auf einer Achse liegenden Balkenwaage in einem zusammenhängenden System zu sehen, in dem sie sich ausgleichen. Kant fand damit eine Lösung für die widersprüchliche Vorstellung, mit negativen Zahlen müsse etwas beschrieben werden, das weniger als Nichts ist. Und doch enthielt diese auf den ersten Blick absurde Vorstellung einen Aspekt, der in der Idee negativer Typen neu aufgegriffen werden kann: Sie sind als bloß Mögliche weniger als Nichts. Damit wird zum Beispiel der scheinbar widersinnige Gebrauch negativer Lagerbestände verständlich: Das sind offene Aufträge auf einen Lagerbestand, den es noch nicht gibt. Diese offenen Aufträge saldieren sich zwar im Sinne des von Kant gemeinten Gedankens mit offenen Bestellungen bei den Kunden, die diese Waren angefragt haben, aber anders als bei den anderen von Kant genannten Beispielen ergibt sich dieser Ausgleich erst in der Zukunft, wenn die Geschäfte realisiert werden. Es ist auch möglich, dass durch unerwartete Ereignisse das Geschäft scheitert und sich die Summe der negativen Lagerbestände als Blase erweisen. Daher genügt es nicht, die negativen Größen auf dem von Kant vorgeschlagenen Weg zu beschreiben, der im Sinne der Typentheorie auf der nullten Stufe argumentiert, sondern zu erweitern auf Möglichkeitsräume in der Zukunft mit negativer Stufe.
(+) Satz des Pythagoras: Die euklidische Geometrie befindet sich an der Grenze zwischen bloß gezeichneten Entwürfen, die zunächst nur auf dem Papier des Geometers stehen, und wirklichen Gegenständen. Welche Eigenschaft müssen sie haben, um sicherzustellen, dass das Entworfene wirklich werden kann und nicht bloß eine unrealisierbare Idee ist? Diese Eigenschaft kann nicht durch die Elemente der Geometrie gegeben sein. Sie muss in einem Prinzip liegen, das sich auf der Schwelle befindet, an der sich erweisen muss, ob die rein geometrischen Konstruktionen zu verwirklichen sind. Ich möchte die Hypothese aufstellen, dass der Satz des Pythagors entweder bereits dies gesuchte Prinzip ist oder ihm nahekommt. Hilbert ist nicht mehr dabei stehen geblieben, den Satz des Pythagoras gleich vielen anderen Sätzen der Geometrie aus den Axiomen der euklidischen Geometrie zu beweisen, sondern er hat umgekehrt Geometrien betrachtet, die ausschließlich durch die Eigenschaft bestimmt sind, dass in ihnen der Satz des Pythagoras gilt. Diese Geometrien – die Hilberträume – haben sich in der Quantenmechanik als Zustandsräume erwiesen, in denen die Ergebnisse der experimentellen Forschung in einer Weise formuliert werden können, dass in ihnen die Naturgesetze darstellbar sind. Damit hat sich gewissermaßen experimentell mit der Physik gezeigt, dass der Satz des Pythagoras das leistet, was ein solches Prinzip erfüllen soll, aber es ist noch nicht ausreichend verstanden oder überhaupt als Frage anerkannt, warum und wie er das leistet.
(+) Wahrscheinlichkeitscharakter der Quantenmechanik: Doch ist dies bisher nur dadurch gelungen, dass Naturerscheinungen ausschließlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beschrieben werden können, die sich ihrerseits mit der mathematischen Gestalt einer Welle im Zustandsraum ausbreitet. Die Naturwissenschaft befindet sich damit auf der Ebene eines Möglichkeitsraums, der vor der beobachtbaren Wirklichkeit liegt. Sie ist so gesehen wie die Mathematik ein Beispiel für eine Sprache mit negativem Typ. Einstein hat sich damit nie zufrieden gegeben. Er hat nicht behauptet, dass die naturwissenschaftlichen Experimente oder die aus ihnen abgelesenen Daten falsch sind, was unsinnig wäre. Aber er hat auf dem Eingeständnis bestanden, dass noch nicht das Prinzip gefunden ist, wodurch die Möglichkeitsdaten der statistischen Analysen wirklich werden. Dies Prinzip kann kein Element oder Eigenschaft innerhalb der Naturwissenschaft sein, sondern es muss wie das Harmonieprinzip bei Leibniz oder der Satz des Pythagoras in der Geometrie den berechenbaren Weg zeigen, wie aus dem Raum der Möglichkeit die Wirklichkeit wird. Dieser Schritt wird in der heutigen Naturwissenschaft nur äußerlich und unzureichend beschrieben, wenn er als Schnitt innerhalb eines Experiments oder als Eingriff durch den beobachtenden Experimentalphysiker bezeichnet wird. Diese Frage ist offen und wird in der Regel von der Physik noch nicht einmal als eine Frage anerkannt.
(+) Begriffsschrift: Freges Begriffsschrift war ein erster Versuch, für die wissenschaftlichen Sprachen eine Art Syntax zu finden. Er hatte nicht nur den Anspruch, überhaupt eine Formalisierung der Sprache zu finden, in der es keine Uneindeutigkeiten mehr gibt, sondern die allgemeingültige Sprache. Er wollte nicht die traditionelle Logik durch einen Vielfalt von Logiken und deren inneren Prinzipien ersetzen, sondern durch eine Neue Logik. Aus meiner Sicht hat er daher zwar maßgeblich dazu beigetragen, die Allgemeingültigkeit der traditionellen Logik zu erschüttern und neue Wege zu öffnen, doch konnte sich seine eigene Lösung nicht durchsetzen. Sie ist im Übrigen auch aus rein technischen Gründen kaum handbar. Niemand hat ernsthaft versucht, komplexere Fragestellungen in der Begriffsschrift von Frege darzustellen und zu lösen. Es scheint mir daher so, dass sie ein Entwurf unter möglicherweise vielen anderen Entwürfen ist, wie eine wirklich nutzbare Begriffsschrift aussehen kann. Sie ist daher zu ergänzen durch eine Vielfalt von Entwürfen, um dann im zweiten Schritt in dieser Vielfalt das innere Prinzip zu erkennen, welche Begriffsschrift nicht nur möglich, sondern wirklich ist. Mögliche Alternativen könnten sich in der Graphentheorie zeigen, den späteren Arbeiten von Gotthard Günther und den Gesetzen der Form von Spencer-Brown, Varianten der Feynmann-Diagramme, verschiedenen Diagrammtechniken im Umfeld von Deleuze (siehe z.B. Simon Duffy [Hg.] Virtual Mathematics, Manchester 2006), vielleicht auch in den von Claus-Artur Scheier entwickelten Formeln zur Darstellung der Systemtheorie von Luhmann, sowie meinen eigenen Versuchen, für die Satz-Theorie zweidimensionale Darstellungen zu finden. – Köhler hält es für einen Skandal, dass der Logizismus heute tot ist (Köhler 2004, S. 91). Mir erscheint eine Wiederbelebung nur möglich, wenn in diesem Sinn das Konzept von Frege neu durchdacht und erweitert wird.
(x) Kleine Perzeptionen. Leibniz geht davon aus, dass in unserer Wahrnehmung eine Zusammenfassung unüberschaubar vieler kleiner Perzeptionen zu den aggregierten Eindrücken erfolgt, aus denen wir unsere Vorstellungen bilden. Sie sind formal auf ähnliche Weise gebildet wie kontinuierliche Mengen. Daher lässt sich der Übergang von den kleinen Perzeptionen zu den Gesamteindrücken formal dem Übergang von den natürlichen zu den reellen Zahlen vergleichen. Versucht der Verstand das rückwirkend zu rekonstruieren und für die kleinen, von ihm nicht einzeln wahrnehmbaren und für ihn ununterscheidbaren Perzeptionen elementare Einheiten zu bestimmen, mit denen sie geordnet und aus deren Ordnung die Gesamteindrücke hervorgehen können, dann stößt er beim Entwurf dieser Einheiten notwendig an die von Gödel entdeckten Unvollständigkeitssätze. Er muss erkennen, dass alle Logiken für Einheiten der kleinen Perzeptionen unvollständig sind und ein zusätzliches Prinzip erforderlich ist, um den Übergang zu den Gesamteindrücken zu erklären. Das legt die Vermutung nahe, dass dies Prinzip mathematisch als eine Verallgemeinerung der Kontinuum-Hypothese verstanden werden kann und im Sinne von Leibniz als Analogie zum Harmonie-Prinzip, mit dem aus der Gesamtheit aller möglichen Welten die wirkliche Welt ausgewählt wurde. Die kleinen Perzeptionen sind zu verstehen als eine Ästhetik (Wahrnehmungslehre) negativer Ordnung, die mit den ihnen entsprechenden Logiken negativer Ordnung durch ein Schema verbunden werden können. Dies Schema lässt sich formal als eine Unschärfe-Relation formulieren und kann als eine Verallgemeinerung des transzendentalen Schemas nach Kant gedeutet werden. – Verwandte Ideen sehe ich in den Entwürfen von Deleuze für eine Kleine Mathematik, der sich ausdrücklich auf Leibniz beruft.
(x) Theorie der Relationen und nicht-prädikative Logik. Gödel nennt im Russell-Papier als Wegbereiter der neuen Logiken neben Leibniz, Frege und Peano den von Peirce und Ernst Schröder entwickelten calculus of relations (Gödel 1990, S. 120). Russell hatte durch ein Verbot von Selbstbezüglichkeiten (vicious circle) drohende Antinomien ausschließen wollen. Das geschieht, wenn ein Element nicht direkt durch Zuschreibung von Prädikaten nach dem Muster ›S ist P‹, sondern durch Verweis auf Relationen in der übergeordneten Klasse definiert wird, in denen es selbst auftritt. Typische Beispiele sind die reellen Zahlen, die durch Intervallschachtelungen in der Menge aller reeller Zahlen definiert werden, aber auch die Russelsche Antinomie der Gesamtheit aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten. Bei den übergeordneten Eigenschaften handelt es sich um Relationen, die genau genommen nicht auf der übergeordneten Klasse, sondern im Kreuzprodukt der übergeordneten Klasse mit sich selbst definiert werden. Das hat innerhalb der traditionellen Philosophie erstmals Hegel mit seiner klaren Unterscheidung von Wahlverwandtschaften und Knotenlinien erkannt, jedoch wurde diese Einsicht in der weiteren Geschichte der Philosophie und Logik nicht aufgegriffen (siehe hierzu den Beitrag über das reale Maß). Kant hat zwar dafür den Boden bereitet, als er mit dem Entwurf der Kategorientafel die Kategorie der Relation in der Urteilstafel systematisch eingeführt hat und dadurch bereits im Ansatz vermeiden will, dass innerhalb der Relationen leere Subjekte auftreten können (siehe hierzu Wolff), doch fehlt bei ihm noch die klare Unterscheidung voneinander unabhängiger Dimensionen einer Ordnung, die erst Hegel entworfen hat. Bei aller Kritik an Kant blieb der Wiener Kreis dabei stehen und versteht die Mehrstufigkeit höherer Typen und Sprachen als einen rein linearen Prozeß. Erst in den Entwürfen selbstreflexiver Systeme sehe ich Ansätze, darüber hinauszugehen. – Aber auch wenn es mit Hegel gelingt, die unterschiedlichen Stufen nicht nur durch eine Reihe, sondern durch Einführung jeweils neuer Dimensionen voneinander zu entkoppeln, ist für mich damit noch nicht ausgeschlossen, dass es auch in höher-dimensionalen Räumen zu Wechselwirkungen, Verschränkungen und übergreifenden Resonanzen kommen kann, wodurch sich auf einer höheren Ebene die Antinomien wiederholen, die mit der Theorie der Relationen vermieden werden sollen. Das kann erst durch Einführung eines zusätzlichen Prinzips vergleichbar dem Harmonie-Prinzip bei Leibniz gelöst werden.
(x) Werte. Die Frage nach dem Harmonie-Prinzip kann als Frage übergreifender Werte verstanden werden, wobei die Harmonie ein Beispiel für einen solchen Wert ist. Hier sieht Köhler einen Ausweg aus der Kontroverse von Carnap und Gödel, wenn in Fortführung von Carnap die Frage nach den Werten aufgegriffen wird. »Now I must destroy Gödel's misconception that Conventionalism always excludes intuition, a mistake which Poincaré, Hilbert and Carnap all fomented.« (Köhler 2014, S. 145) Gödel hatte Poincaré, Hilbert und Carnap vorgehalten, dass sie rein formal Theorien entwickeln, während er eine Intuition für erforderlich hält, mit der die Theorie nicht willkürlich entwickelt, sondern aus der Sache begründet wird. Eine solche Begründung kann nicht mathematisch errechnet werden, sondern sie muss als Intuition dem mathematischen Entwurf vorausgehen. Aber entgegen ihrer Selbstdarstellung enthalten die Theorien von Poincaré, Hilbert und Carnap durchaus eine Intuition, die ihnen nur nicht bewusst wird. Wenn sie empirisch und induktiv vorgehend an irgendeinem Punkt die Entscheidung treffen, dass nicht nur eine unvollständige Folge von Daten vorliegt, sondern ein zusammenhängendes Gesetz, dann treffen sie an dieser Stelle eine Wert-Entscheidung, mit der sie das gefundene Ergebnis gegenüber einer beliebigen Zahlenreihe auszeichnen. Es ist nicht mehr nur eine chaotische Zeichenreihe, aus der formal unendliche viele Verallgemeinerungen geschlossen werden können, sondern mit einer Wert-Entscheidung wird für sie zu einem Gesetz erklärt, das wirklich ist. Wenn es gelingt, die Wert-Entscheidung explizit zu machen, ist das gesuchte Prinzip gefunden.
(x) Wahrheits-Transformationen. Um den Anspruch einer Wissenschaft gerecht zu werden, genügt es nicht, Werte wie ‘das Gute’ oder ‘Harmonie‘ in Worte zu fassen und als Anfangsgrund einer Wissenschaft zu setzen, sondern es muss gelingen, innerhalb der Wissenschaft Transformationen zu entwickeln, mithilfe derer diese Werte sich im Übergang unterschiedlicher Logiken erweisen. Beispiele sind der Währungsmechanismus als Transformation unterschiedlicher Geldwerte oder die Lorentz-Transformationen in der Physik (siehe hierzu erste Ideen im Beitrag zur Prädikationstheorie von Peter Ruben).
Literatur
Mark van Atten: Monads and sets. On Gödel, Leibniz, and the reflection principle
in: G. Primiero and S. Rahman (Hg.): Judgement and Knowledge, London 2009, S. 3-33; Link
Mark van Atten, Juliette Kennedy: On the Philosophical Development of Kurt Gödel
in: Bulletin of Symbolic Logic, Volume 9, Number 4, Dec. 2003, S. 425-476; Link
Bernd Buldt, Eckehart Köhler u.a. (Hg.): Kurt Gödel, Wahrheit und Beweisbarkeit, Wien 2002, 2 Bd.
Rudolf Carnap: Logische Syntax der Sprache, Wien, New York 1968 [1934]
Mauro Dorato: Kant, Gödel and Relativity
in: in P. Gardenfors, K. Kijania-Placek and J. Wolenski (Hg.): Proceedings of the invited papers for the 11th International Congress of the Logic Methodology and Philosophy of Science, Synthese Library, Kluwer, Dordrecht, 2002, S. 329-346; Link.
Kurt Gödel (Gödel 1990, 1995, 2003a, 2003b): Collected Works, Bd. II - V, Oxford 1990, 1995, 2003, 2003
Frank Grave: The Gödel Universe, Stuttgart 2010; Link
Gotthard Günther: Logistik und Transzendentallogik
in: Günther: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, Bd. 1, Hamburg 1976, S. 11-23 [1940]
Jaako Hintikka: Kant on the Mathematical Method
in: Carl J. Posy (Hg.): Kant's Philosophy of Mathematics, Dordrecht 1992, S. 21-42 [1967]
Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, 1. und 2. Auflage, Riga 1781 und 1787 (zitiert als KrV, A und B)
Immanuel Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, Riga 1783
in: Akademie-Ausgabe Band IV, Berlin 1911 AA IV Volltext (zitiert als Prol.)
Immanuel Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Riga 1786
in: Akademie-Ausgabe Band IV, Berlin 1911; AA IV Volltext (zitiert als MAN)
Eckehart Köhler (Köhler 2004): Ramsey and the Vienna Circle on Logicism
in: Maria Carla Galavotti (Hsg.): Cambridge and Vienna, Vienna Circle Yearbook 12, Springer 2004, S. 91-121
Eckehart Köhler (Köhler 2014): Gödel and Carnap, Platonism versus Conventionalism?
in: Galavotti, Nemeth & Stadler (Hg.): Philosophy of Science in Europe and the Vienna Heritage, Vienna Circle Yearbook 17, Springer 2014, S. 131-158
Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, Hamburg 1952; Link
Georg Picht: Aristoteles' »De Anima«, Stuttgart 1992
Georg Picht: Von der Zeit, Stuttgart 1999
Chris Smeenk und Christian Wüthrich: Time Travel and Time Machines
in: Craig Callender (Hg.): The Oxford Handbook of Philosophy of Time, Oxford 2011, S. 577-630; Link
Claudio Ternullo: Gödel's Cantorianism
in: Eva-Maria Engelen, Gabriella Crocco (Hg.): Kurt Gödel: Philosopher-Scientist, Aix en Provence 2015, S. 417-446
Hao Wang: Time in philosophy and in physics: From Kant and Einstein to Gödel
in: Synthese February 1995, Volume 102, Issue 2, S. 215-234; Link
Michael Wolff: Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel, Frankfurt am Main 1995
Palle Yourgrau: Gödel, Einstein und die Folgen, München 2005
2014-2016
© tydecks.info 2016