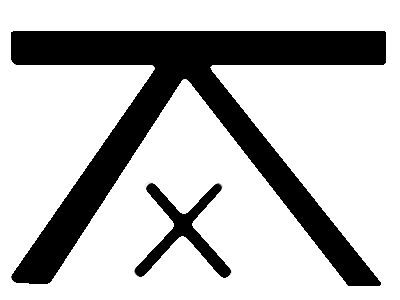Walter Tydecks
Entwurf für eine dynamische Logik
nach Leibniz und Gödel
– Die kleinen Perzeptionen bei Leibniz und die Kontinuum-Hypothese nach Gödel
Vortrag beim X. Internationalen Leibniz-Kongress, Hannover 18.-23. Juli 2016, überarbeitete Version. (Die ursprüngliche Version liegt vor in: Wenchao Li (Hg.) „Für unser Glück oder das Glück Anderer”, Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hildesheim 2016, Bd. IV, S. 221-233)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Grund
2 appetitus
3 Zusammenhalt
4 Harmonie, Fruchtbarkeit
Anhänge und Beilagen
Aristoteles und Platon
Gödels Kritik an Hegels Anfang der Wissenschaft der Logik
Der ontologische Gottesbeweis von Gödel
Abstract Die ersten Anfänge einer dynamischen Logik gehen auf Aristoteles zurück. Für ihn können das Kontinuum und die Zeit nicht aus dimensionslosen Punkten zusammengesetzt sein, sondern sie bestehen aus bewegten, kleinsten Einheiten im Übergang von Möglichkeit (dynamis) zu Wirklichkeit (energeia). Wie lässt sich mit ihnen rechnen? Leibniz versteht sie als Differentiale dx und dy, für die er einen eigenen Kalkül entwickelte (den Differentialkalkül), der im Grenzübergang in den Kalkül der üblichen Zahlen übergeht. In der Monadologie unterscheidet er auf ähnliche Weise zwischen den gewöhnlichen Perzeptionen und den kleinen Perzeptionen, aus denen sie zusammengesetzt sind, die aber für uns ununterscheidbar sind. Ihr Verhältnis ist das Modell einer dynamischen Logik, die von den halbfertigen und noch in der Entwicklung begriffenen Elementen eines Möglichkeitsraums zu den festen Elementen der Wirklichkeit führt. Es muss zwischen den halbfertigen Elementen des Möglichkeitsraums Zuneigungen geben (Leibniz spricht von appetitus), aus denen ihre Dynamik entsteht und durch die sie sich zu Aggregaten zusammenschließen, die in die Wirklichkeit treten. Wenn im Ergebnis aus der Vielzahl aller möglichen Verknüpfungen eine Selektion getroffen wird, die von der Möglichkeit zur Wirklichkeit führt, erfolgt die Auswahl für Leibniz nach dem Harmonie-Prinzip. Gödel hat diese Ideen Punkt für Punkt in seine eigenen Arbeiten übernommen, wenn er vom Kontinuum, der Unvollständigkeit, den imprädikativen Eigenschaften und der Fruchtbarkeit spricht. Das begründet das mathematische Programm einer dynamischen Logik.
Einleitung
Obwohl Leibniz für Gödel – wie auch für Einstein – der Lieblingsphilosoph war, mit dem er sich sein Leben lang beschäftigt hat, gibt es kaum Äußerungen, in denen er zusammenhängend auf Leibniz Bezug nimmt. In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie sich in den verschiedenen Arbeiten von Gödel ein roter Faden erkennen lässt, der auf Leibniz zurückgeht. Das ist für mich ein eigener Ansatz, nicht nach neuen formalen Systemen oder einer Universalsprache zu suchen, der sich ebenfalls auf Leibniz berufen könnte, sondern die Logik zu begründen auf einem prä-logischen Raum von Aussagen, die erst vage, halbfertig und im Bereich des Möglichen liegen, bevor aus ihnen Protokollsätze und wissenschaftlich abgesicherte Aussagen hervorgehen, die mit den Mitteln der formalen Logik dargestellt werden. Diese Logik ist nicht mehr ein statisches System der Beziehungen und Schlussfolgerungen von Aussagen über starre Objekte und deren symbolischen Darstellungen, sondern ein an natürlichen Wachstumsprozessen orientiertes logisches Entwicklungsmodell. Dieser Ansatz gibt zugleich eine neue Sicht auf die Paradoxien der Logik und Mathematik, wenn ihr besonderer Ort und Status im Entwicklungsprozess berücksichtigt wird.
Vorbild für diesen Ansatz sind die Kleinen Perzeptionen, die Leibniz in seiner Monadologie eingeführt hat. Leibniz unterscheidet in der Monadologie zwischen den »kleinen Perzeptionen«, »die nicht zum Selbstbewußtsein gelangen« (»perceptions, dont on ne s’ aperçoit pas« im französischen Originaltext), und der Perzeption im üblichen Sinn (Leibniz, Monadologie, §§ 14, 21). Ich verstehe die kleinen Perzeptionen als den Grund, aus dem die Perzeptionen nach vergleichbaren Regeln ins Bewusstsein treten wie das Wirkliche aus dem Möglichen hervorgeht. In einer weiteren Analogie können die von Leibniz eingeführten Differentiale als Grund der reellen Zahlen verstanden werden. Leibniz und Gödel haben mit dem Differentialkalkül bzw. den Unvollständigkeitssätzen erste Ideen für eine Logik des Möglichkeitsraums und ihren Übergang in die Wirklichkeit entwickelt.
Diese These soll an vier Punkten ausgeführt werden:
– Der Möglichkeitsraum als Grund der Wirklichkeit
– Der appetitus als elementare Wechselbeziehung zwischen den Elementen im Möglichkeitsraum
– Der Zusammenhang oder das Kontinuum als übergreifende Eigenschaft des Möglichkeitsraums
– Und schließlich die Harmonie als Prinzip, dank dessen aus der Vielfalt der Möglichkeiten die Wirklichkeit hervorgeht. Ihr entspricht in den Entwürfen von Gödel das Fruchtbarkeits-Prinzip (fruitfulness), eine Art Meta-Prinzip für die mathematische Axiomatik
1 Grund
Als Grund ist nicht wie bei Kant oder der formalen Logik nach Frege eine Kausalitätskette ›aus A folgt B, aus B folgt C usf.‹ gemeint, wobei jedes Element der Grund seines Nachfolgers ist, sondern ein Möglichkeitsraum, aus dem das Wirkliche hervorgeht. Das kann anschaulich gesprochen der Boden sein, der eine Vielfalt von Möglichkeiten enthält, die mit Saatgut oder Setzlingen versehene Ackerfurche oder in einem anderen Bild ein Embryo, das sich geschützt im Mutterleib entwickelt. Das können stärker mathematisch gesprochen die Differentiale dx, dy, … sein, aus denen die reellen Zahlen entstehen, und darauf aufbauend mit der im 20. Jahrhundert entwickelten geometrischen Ableitung (Geometric Differentiation) der Übergang von Keimen (Germ) aus topologischen Räumen in ihre physikalischen Anwendungen. – In einem weiten philosophischen Sinn kann es die causa sein in der doppelten Bedeutung von Grund und Sache. Die Sache selbst ist der Grund, aus dem heraus etwas verstanden und im Horizont aller alternativen Möglichkeiten gesehen wird.
Der Grund enthält nichts Unmögliches. Insofern gilt auf eine triviale Art das tertium non datur: Etwas kann nicht zugleich möglich und unmöglich sein. Aber es wird sich zeigen, dass im Grund die metaphysischen Sätze und Reflexionsbegriffe der Identität, des Unterschieds, des Widerspruchs und des zureichenden Grundes nur eingeschränkt gelten. Der Grund besteht aus jeweils noch unfertigen Elementen, die sich in der weiteren Entwicklung voneinander differenzieren, in Widerspruch zueinander geraten oder umgekehrt in höhere organische Einheiten zusammenwachsen können. Im Bereich des Möglichen können zwei Keime (Optionen) nebeneinander bestehen, auch wenn beide in der weiteren Entwicklung einander widersprechen (vgl. hierzu Holz, S. 119). Wenn das eine wirklich wird, kann das andere nicht wirklich werden. Insofern ist im Möglichkeitsraum das tertium non datur verletzt und im Grunde nur eingeschränkt gültig.
Die Unvollständigkeitssätze von Gödel können rückwärts gelesen werden. In einem unvollständigen System kann es Elemente geben, die aufgrund ihrer Unvollständigkeit nicht klar voneinander getrennt werden können. Sie tragen ein genau zu definierendes Maß an Ununterscheidbarkeit an sich. Hierfür gibt es viele Ansätze und Beispiele: (a) Wenn in der Algebra mit Buchstaben statt mit Zahlen operiert wird, wird bewusst unbestimmt gelassen, welche Zahlen einzusetzen sind. (Siehe hierzu in seinem Leibniz-Buch die Ausführungen von Ortega y Gasset zur Algebra, S. 52-67). (b) Innerhalb der natürlichen Zahlen gibt es eine unbestimmbare Grenze, ab der die großen Zahlen sich der Anschauung entziehen, »what Gödel called the 'big jump'« (Wang, S. 213 im Kapitel über Platonismus und Finitismus). Dieser Gedanke entzieht sich dem Vorstellungsvermögen des Verstandes. Jeder kennt die formale Regel, dass ich mir zu einer beliebig großen Zahl n die nachfolgende Zahl n + 1 vorstellen kann, und doch ist zugleich auch die Intuition von Gödel einleuchtend, dass irgendwo im Ganzgroßen wie am Horizont die Zahlen in ihrer Unterscheidbarkeit verschwimmen. Jeder Informatiker kennt das, wenn der Adressraum für darstellbare Zahlen endlich ist oder mit der Bremermann-Grenze eine endliche Zahl gefunden ist, jenseits derer nicht mehr gerechnet und Daten entschlüsselt werden können. (c) Da gezeigt werden kann, dass das Universum aller Mengen keine Menge ist, muss es unter den Mengen größte Mengen geben, die nicht überschritten werden können. Sie zu überschreiten ist für Gödel ein "second jump" (Wang, S. 258). Gödel war überzeugt, dass für diese Grenze ein Maximum-Prinzip gefunden werden kann, das er mit dem Gravitationsgesetz der Physik verglich, mithilfe dessen die offenen Fragen der Mengenlehre lösbar sind. (Wang, S. 262). Die Mengen jenseits dieser Grenze sind ununterscheidbar. (d) Das bekannteste und treffendste Beispiel sind die Differentiale wie dx und dy. Das sind verschwindende Größen, deren Ort nur in Grenzprozessen angenähert, und mit denen dennoch mithilfe des von Leibniz entwickelten Differentialkalküls gerechnet werden kann. Sie werden heute mit ε-Kugeln beschrieben. Die Elemente innerhalb einer ε-Kugel können nicht unterschieden werden. Es kann nur definiert werden: Wird aus einer ε-Kugel ein beliebiges Element ε0 herausgegriffen, dann gibt es eine kleinere ε-Kugel ε', in der dieses Element nicht enthalten ist.
Die kleinsten Einheiten des Grundes können nicht individualisiert werden. Sie sind in definierten Grenzen ununterscheidbar. Ihnen können keine einfachen Prädikate zugeschrieben werden, sondern sowohl den Elementen wie ihren Eigenschaften werden nur künstliche Namen mit einer unsicheren Referenzmenge verliehen. Wird ein Element herausgegriffen, kann das nur willkürlich sein, und es ist reiner Zufall, welches Element aus der Referenzmenge getroffen wurde. (Mit diesem von Paul Cohen entwickelten Ansatz soll nach Wang sogar Gödel Schwierigkeiten gehabt haben. »In Cohen's proofs one makes generality or impossibility statements about what one does not know. Nobody can understand this.« [Wang, S. 252]).
Auf diese Weise wird das Paradox von Zufall und zureichendem Grund gelöst. Der Zufall (oder die Wahrscheinlichkeit) verletzt nicht das Prinzip des zureichenden Grundes, wenn es innerhalb des Grundes gilt, in dem die unfertigen Elemente noch nicht voll unterscheidbar sind.
Zusammenfassend: Im Grund gelten die üblichen Bedeutungen der Reflexionsbegriffe Identität, Unterschied, Widerspruch und Grund nur eingeschränkt. Die klassischen Sätze der Metaphysik sind noch nicht voll-gültig. (i) Für unfertige Elemente A lässt sich nur annäherungsweise die Identität A = A postulieren. (ii) Sind zwei Elemente A und B ununterscheidbar, ist der Satz des Unterschieds verletzt. (iii) Es kann Elemente A und B geben, die beide möglich sind, aber nicht gleichzeitig verwirklicht werden können. (iv) Und der Satz ‘Alles hat einen zureichenden Grund’ gilt in dem in Bewegung befindlichen Möglichkeitsraum nur vorläufig: Es kann sich herausstellen, dass ein Element A sich nur weiter entwickeln kann und Bestand erlangt, wenn es mit einem anderen Element B zusammenwächst, so dass sich formal in der weiteren Entwicklung B als ein Grund von A erweist.
Wenn wie üblich die wirklichen Objekte als nullte Ordnung, die auf sie verweisenden Zeichen als erste Ordnung, die Metasprache über diese Zeichen als zweite Ordnung usf. bezeichnet werden, dann können die virtuellen, unfertigen Objekte des Möglichkeitsraums als erste negative Ordnung bezeichnet werden, die Gesamtheit aller möglichen Namen für mögliche Objekte als zweite negative Ordnung usf. (Siehe Köhler 2004, S. 114).
Die Idee des Möglichkeitsraums reicht sehr weit. Er enthält nicht nur die Vielfalt aller Möglichkeiten, sondern auch die Spuren des Vergangenen und Zukünftigen:
»In jeder Substanz sind Spuren von all dem, was ihr begegnet ist, und von allem, was ihr noch begegnen wird, vorhanden. Die unendliche Vielheit der Perzeptionen aber macht es unmöglich, sie voneinander zu unterscheiden.« (Leibniz, Aufklärung der Schwierigkeiten Bayles, 1698, in: Leibniz 1996b, S. 467)
Mit der Spur ist eine theologische Bedeutung verbunden: Die auf Isaak Luria (1534-1572) zurückgehende Idee des Zimzum, des sich aus der Welt zurückziehenden Gottes. An seine Stelle tritt die neuzeitliche Wissenschaft, und ihr Siegeszug hat in pessimistischen Deutungen den »europäischen Nihilismus« (Nietzsche) oder die »Seinsverlassenheit« (Heidegger) zur Kehrseite. Das kann aber auch optimistisch gesehen werden: Gott zeigt sich nicht in den in ihrer Endgültigkeit erstarrten wirklichen Dingen, wie es ein vulgärer Materialismus vertritt, sondern in der Vielfalt der Möglichkeiten und der mit ihnen dem Menschen verliehenen Freiheit und Lebendigkeit.
2 appetitus
Die verschiedenen Möglichkeiten liegen nicht einfach nach dem Modell einer Potenzmenge (der Menge aller Untermengen einer gegebenen Menge) gleichberechtigt und äußerlich nebeneinander. Die Menge von nächsthöherer Mächtigkeit ergibt sich nicht einfach als Gesamtheit aller möglichen Kombinationen aus den Elementen einer gegebenen Menge. Mit der Anzahl aller möglichen Kombinationen kann für Gödel nur eine obere Schranke für die nächsthöhere Mächtigkeit abgeschätzt werden. Stattdessen ist aus der Gesamtheit aller kombinatorischen Möglichkeiten eine Auswahl zu treffen. Da es sich um eine Auswahl aus einer mathematischen und nicht aus einer natürlichen, gegebenen Menge handelt, kann für die Auswahl nur ein formales Verfahren gefunden werden, eine Regel, wie eine solche Auswahl zu treffen ist.
Der einfachste Ansatz ist das 1904 von Zermelo aufgestellte Auswahlaxiom, ohne das keine Axiomatisierung der Mengenlehre möglich geworden wäre: Aus jeder Menge wird stellvertretend ein einzelnes, beliebiges Element ausgewählt (Auswahlfunktion). Für die Auswahl können schrittweise zusätzliche Bedingungen gestellt werden: Wenn es sich um eine geordnete Menge handelt, soll das kleinste Element ausgewählt werden. Wenn die Größe aller Elemente bekannt ist, soll der statistische Mittelwert genommen werden. Weitergehend kann verlangt werden, dass das auszuwählende Element aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit stellvertretend für die Menge steht.
Während diese Auswahlverfahren von außen an eine gegebene Menge von Möglichkeiten herangetragen sind, ging Leibniz davon aus, dass die Elemente über eine innere Dynamik verfügen und sich dank ihrer Eigenschaften von sich aus zu bestimmten Gruppen zusammenschließen (appetitus). Es muss zwischen ihnen eine innere Affinität geben. So auch Kant in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft: »Der Grund der Möglichkeit der Assoziation des Mannigfaltigen, sofern es im Objekte liegt, heißt die Affinität des Mannigfaltigen.« (Kant, KrV, A 113) (Siehe hierzu den kurzen Kommentar über Kant zum Prinzip der Affinität.) Hegel hat das fortgeführt und ausgehend vom Beispiel chemisch reagierender Stoffe als Wahlverwandtschaften bezeichnet (siehe Hegel in der Wissenschaft der Logik über das reale Maß und eine interpretierende Logik-Studie).
Doch gibt es für Hegel auch andere Beispiele für Wahlverwandtschaft: Töne suchen einander und bestimmte Töne klingen harmonisch oder weniger harmonisch zusammen. In einer weiteren Abstraktion halte ich für denkbar, dass es innerhalb der natürlichen Zahlen bestimmte Zahlen gibt, die besser oder schlechter zueinander passen und innerhalb der bloßen Nachfolger-Relation höhere Ordnungen bilden. Die Primzahlforschung beschäftigt sich mit Fragen dieser Art, und es ist für mich eins der erstaunlichsten Resultate der neueren Mathematk, als der Mathematiker Manjul Bhargava (*1974) gemeinsam mit Jonathan Hanke nachweisen konnte, dass für Fragestellungen wie z.B. ›Läßt sich jede natürliche Zahl als Summe von 4 Quadratzahlen darstellen‹ »ein Test mit genau 29 Zahlen genügt, um die Frage zu beantworten. [...] Hier sind die 29 Zahlen: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 42, 58, 93, 110, 145, 203, 290« (Spiegel-Online vom 15.8.2014). Diese Zahlen bilden aus für mich unklaren Gründen eine Referenzmenge für induktive Gesetzmäßigkeit. – Während sich jedoch Kant und Hegel mit Affinität bzw. Wahlverwandtschaft auf physische Elemente beziehen, versteht Leibniz den appetitus als eine Eigenschaft der Monaden, die nicht mit der physischen Welt verwechselt werden dürfen.
Wie auch immer die Beziehungen zwischen den Elementen des Möglichkeitsraums formuliert werden, es handelt sich mathematisch gesehen um Relationen. Die Gesamtheit aller Beziehungen ist der Raum aller möglichen Relationen. Die hier betrachteten Relationen befinden sich ihrerseits im Raum der Möglichkeit, d.h. es kann auch Relationen geben, die einander widersprechen. Nur eine von ihnen kann sich verwirklichen.
Gödels Beweisidee des Unvollständigkeitssatzes besagt, dass sich in diesem Raum Objekte und Relationen nicht scharf voneinander trennen lassen. Im ersten Schritt kann der traditionellen Logik folgend jedes Objekt durch alle seine Beziehungen zu anderen Objekten und jede Beziehung durch alle Objekte, für die sie gilt, beschrieben und definiert werden. Darüber hinaus kann Gödel folgend jede Aussage, Operation und Turing-Maschine durch das Verfahren der Gödelisierung als Gödelnummer und damit als Element dargestellt werden. Jede Zahl kann sowohl ein Objekt wie eine Relation sein. Werden mit Leibniz die Relationen als Zuneigungen (appetitus) verstanden, dann kann jedes Element sowohl das zeigen, was etwas in seiner Unvollständigkeit im Möglichkeitsraum ist, wie auch seine Neigung (Relation) zu anderen.
Mit diesem Ansatz konnte Gödel zeigen, dass in ausreichend mächtigen formalen Systemen das Lügner-Paradoxon formuliert werden kann, und später ebenso das unlösbare Halteproblem der theoretischen Informatik. Mit dieser Beweisidee hat Gödel die prinzipielle Unvollständigkeit formaler Systeme bewiesen.
3 Zusammenhalt
Es genügt jedoch nicht, nach den Relationen (Neigungen) zwischen den Elementen einer Menge zu fragen, sondern sowohl die Elemente wie ihre Relationen sind in einer Weise anzuordnen, dass sie ein Kontinuum ergeben. Das bekannteste und für Gödel maßgebliche Beispiel ist die Intervallschachtelung für die Definition reeller Zahlen. Mit jedem Intervall ist eine elementare Relation zwischen allen Elementen des Intervalls gegeben, die in der gemeinsamen Zugehörigkeit zum gleichen Intervall besteht. Eine reelle Zahl wird selbstreferentiell als Schnittmenge aller Intervalle definiert, denen sie angehört.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, wie eine dynamische Logik auf Aristoteles zurückgehen kann, der in seiner Physik am Beispiel der Antinomien von Zenon den Begriff des Kontinuums (synecheia) eingeführt hat (siehe den Kommentar zum Begriff des Kontinuum bei Aristoteles).
Leibniz hatte als Beispiel für die kleinen Perzeptionen das Meeresgeräusch genannt. Wer das Meeresrauschen hört, hört im Grunde unterhalb der Reizschwelle die Geräusche der einzelnen Wassertropfen, aus deren Bewegung sich das Geräusch des Meeres zusammensetzt. Es genügt jedoch nicht die Vorstellung, dass sich aus abzählbar vielen Wassertropfen ein ganzes Meer bildet. Sondern es muss zweierlei hinzukommen: Aus Sicht des Meeres sind die einzelnen Wassertropfen ununterscheidbar, und aus Sicht der einzelnen Wassertropfen muss es einen Zusammenhalt geben, damit sie sich zum Meer zusammenfügen. Dieser Zusammenhalt ist mehr als eine Aufzählung. Er kann mit den spezifischen Eigenschaften des Aggregatzustandes des flüssigen Wassers beschrieben werden.
Die Flüssigkeit ist ein Beispiel für einen Zusammenhalt, der im Kontinuum des Meeres entsteht. Die Wassertropfen und das Meer sind nicht zwei Zustände des gleichen Substrats, es sind nicht nur zwei verschiedene Ordnungen des gleichen Materials oder zwei Relationen unterschiedlicher Reichweite, so wie z.B. die Ordnung der Atome innerhalb der Ordnung der Moleküle oder der Moleküle innerhalb des Organismus liegen, sondern mit dem Zusammenhalt ist eine Eigenschaft gegeben, die nur für die jeweilige Totalität und nicht für die isolierten Elemente gilt. Der Zusammenhalt ist ein Beispiel für Imprädikabilität (Impredicativity) im Sinne von Poincaré, Russell und Carnap: Etwas hat einen Zusammenhalt, wenn es einer Totalität angehört, die einen Zusammenhalt hat.
Gödel hat sich ausdrücklich gegen Russells Verbot selbstbezüglicher Definitionen gestellt (vicious circle). Stattdessen hat er der selbstbezüglichen Definition eine ganz bestimmte Aufgabe gegeben: Mit ihr lässt sich definieren, was ein Ganzes von seinen Teilen unterscheidet. Selbstbezügliche Definitionen sind eine Eigenschaft, die nur für das Ganze und nicht für die isolierten Teile gilt. Das tun zu können, ist für ihn ein eigenes, unabhängiges Prinzip mit einem genau zu bestimmenden Gültigkeitsbereich: Es gilt wie die Verletzung des tertium non datur und das Paradox von Zufall und Grund nur innerhalb des Möglichkeitsraums. Selbstbezügliche Definitionen wie der Zusammenhalt gelten nur in einer dynamischen Logik, die etwas beschreibt, das sich noch in der Entwicklung befindet und dessen Erfolg gefährdet ist. Erst bei Betrachtung der fertigen, verwirklichten Gegenstände sind Selbstbezüglichkeiten auszuschließen. Dort gilt sowohl das tertium non datur wie Russells Verbot. (Anmerkung: Auf ähnliche Weise hatte bereits Cantor ein Paradox in eine Definition umgewandelt. Es ist ein bereits von Leibniz untersuchtes Paradox, dass es genau so viele Quadratzahlen gibt wie natürliche Zahlen, obwohl die Quadratzahlen eine echte Teilmenge der natürlichen Zahlen sind. Cantor drehte das um und machte daraus die Definition von unendlichen Mengen: Eine unendliche Menge ist durch die Eigenschaft definiert, dass sie Teilmengen enthält, die die gleiche Anzahl Elemente haben wie die Gesamtmenge.)
Der hier gemeinte Zusammenhalt zeigt sich bei der Erkennung von Spuren und Schriften. Wer einer Spur folgt, sucht nach Merkmalen, wie entlang einer Spur von einem Element auf das nächste geschlossen werden kann. Es wird angenommen, dass es innerhalb der Spur eine durchgehende Kontinuität gibt. Und wer an archäologisch entdeckten Zeichen eine Schrift erkennen will, sucht nach dem inneren Zusammenhalt der gegebenen Zeichen, die einen Sinn ergeben sollen.
4 Harmonie, Fruchtbarkeit
Die bisher ausgeführten Begriffe können mit den drei Grundbegriffen der Physik verglichen werden: Der Boden liefert die Masse, aus der alles hervorgeht und gewichtet wird. Die Relationen sind die Kräfte, die zwischen den Elementen innerhalb der unförmigen Masse bestehen. Die Kontinuität ist die Energie, wenn sie als Vermögen verstanden wird, einen Prozess kontinuierlich von Anfang bis Ende durchzuhalten und alle erforderlichen Ressourcen heranzuziehen und zu nutzen. – Als weitere Analogie kann die Musik dienen: Der Ton-Vorrat ist der Boden, aus dem die Musik hervorgeht. Intervalle und Akkorde sind die Relationen von Tönen, in Melodien zeigt sich die innere Kontinuität des musikalischen Prozesses. (Ergänzung: Während des Leibniz-Kongresses wurde das von Xie Xin für einen Wettbewerb anlässlich des Leibniz-Gedenkjahres geschriebene Stück Unnatural Nature für Klarinette solo vorgetragen, worin dieser Gedanke sehr gut hörbar wurde, siehe NMZ vom 3.7.2016 und die Ausschreibung Leibniz' Harmonien 2016.)
Zu ergänzen bleibt die Harmonie. Grund, appetitus und Kontinuität sind noch wertfrei. Sie können in einem statischen Zustand verbleiben vergleichbar dem absoluten Wärmetod. Erst mit Harmonie und Fruchtbarkeit entsteht Leben. Mit Harmonie ist nicht nur gemeint, dass etwas schön ist, sondern dass alle bisher genannten Prinzipien in eine höhere Einheit gefügt werden.
Gödel hat dies Prinzip eigenartigerweise nicht für die Elemente einer Menge gefordert, sondern für den kreativen Prozess. In seinem Beitrag über Russell bekennt er sich zum Anliegen von Leibniz. Er versteht dessen Characteristica universalis ausdrücklich nicht als ein »utopian project«, sondern als einen »calculus of reasoning to a large extent«. Leibniz hatte erwartet, dass dies bei Mithilfe einiger Wissenschaftler eine Sache von vielleicht 5 Jahren und von großem Gewinn (»fecundity«) wäre. (Gödel, CW 2, S. 140f)
Auf ähnliche Weise erwartet Gödel von neuen Axiomen der Mengenlehre eine besondere »fruitfulness«. Bis zu seinem Lebensende suchte er nach Axiomen, mit denen die Mengenlehre auf neue Weise begründet und die Kontinuum-Hypothese beantwortet werden kann (siehe die drei Manuskripte von 1970, Gödel, CW 3, S. 420-425). Die neuen Axiome sind nur erfolgreich, wenn sie fruchtbar eingesetzt werden können.
»Success here means fruitfulness in consequences, in particular in 'verifiable' consequences, i.e., consequences demonstrable without the new axiom, whose proofs with the help of the new axiom, however, are considerably simpler and easier to discover, and make it possible to condense into one proof many different proofs.« (Gödel, CW 2, S. 261, vgl. auch S. 269)
Im engeren Sinn ist für Gödel die Kontinuum-Hypothese die Frage, ob und wie mit den Kardinalzahlen gerechnet werden kann. Ist es möglich, eine Formel zu finden, in der eine Kardinalzahl aus der anderen hervorgeht? Eine solche Formel wäre von ähnlicher Bedeutung wie die Formel F = m · a (Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung), mit der die Grundbegriffe der Physik verknüpft werden. Er vermutete, dass für die Mächtigkeit des Kontinuums die Formel aufgestellt werden kann: 2ℵ0 = ℵ2. Anders als in der üblichen Kontinuum-Hypothese setzt er für die Mächtigkeit des Kontinuums ℵ2 und nicht ℵ1, da er überzeugt ist, dass in die Mächtigkeit des Kontinuums nicht nur die Gesamtheit aller Untermengen natürlicher Zahlen, sondern auch die Kontinuität ihrer Relationen untereinander eingeht.
Ohne dies inhaltlich weiter auszuführen, geht es hier um die Frage, mit welchen Axiomen von einer Mächtigkeit zur nächsten gelangt und eine Formel wie diese aufgestellt werden kann. Nach meiner Überzeugung genügt es nicht, die Fruchtbarkeit eines Axioms bezüglich seiner Konsequenzen zu finden, sondern auch für die Menge selbst ein Axiom der Fruchtbarkeit zu setzen, dank derer diese Menge die nachfolgende Menge von höherer Mächtigkeit hervorzubringen vermag.
Das Fruchtbarkeits-Prinzip ist für mich der Sache nach identisch mit dem Harmonie-Prinzip von Leibniz. Gödel hat kongenial getroffen, was Leibniz meinte und es vielleicht sogar deutlicher auf den Punkt gebracht. Wenn formal die Potenzmenge mit der Gesamtheit aller möglichen Welten verglichen wird, dann ist ein weiteres Prinzip notwendig, um aus dieser Gesamtheit die wirkliche Welt zu verstehen. Das ist für Leibniz das Harmonie-Prinzip, und es scheint mir Gödels – wenn auch noch nicht ausformulierter – Gedanke zu sein, dass das für die Mengenlehre verallgemeinert werden kann, wobei die Menge höherer Mächtigkeit für die Wirklichkeit steht, die aus der Potenzmenge einer Menge niedrigerer Mächtigkeit hervorgeht.
An diesem Punkt verschlingt sich ein letztes Mal auf dreifache Weise eine Reflexion mit ihren Selbstreflexionen: Das höchste Prinzip des Möglichkeitsraums ermöglicht den Übergang zur Wirklichkeit. Dies Prinzip kann seinerseits nur gefunden werden, wenn für die Menge der Prinzipien selbstreflexiv ihre eigene Harmonie (Fruchtbarkeit) gilt. Und diese Prinzipien sollen gewonnen werden, indem die bei Leibniz und Gödel noch unvollständig ausgearbeiteten Gedanken fortgeführt werden und ihren eigenen Wert erst darin zeigen, wenn sie ihrerseits in Zukunft weiter ausgearbeitet werden können.
Anhänge und Beilagen
Platon und Aristoteles
Im Timaios beschreibt Platon das Chaos mit seinen Keimen (Formspuren, ichne ton eidon), aus denen etwas geschaffen werden kann. Das erinnert an Aristoteles, und Heidegger vermutet, dass Aristoteles Begriffe wie dynamis und genos eigenständig entwickelt hat und Platon darauf in seinen späten Schriften reagiert (Heidegger, Platons Sophistes, Frankfurt 1992, S. 483-485, 510). Doch gibt es zwischen beiden einen Gegensatz: Während für Aristoteles die Natur aus sich heraus zu etwas strebt (entelecheia), bedarf es für Platon des Baumeisters (Demiurgen), der von außen die noch chaotische Natur formt.
Die Stelle bei Platon lautet:
»Doch ermangelten sie damals noch aller Ordnung und alles Maßes; sobald dagegen Hand an die Bildung des Weltalls gelegt wurde, so verlieh Gott zuerst dem Feuer, dem Wasser, der Luft und der Erde, die bisher zwar wohl schon gewisse Spuren von ihrer eigentlichen Beschaffenheit an sich trugen, aber sich doch mit ihnen in einem Zustande befanden, wie er eben bei keinem Gegenstände anders sein kann, solange Gott von ihm fern ist, ihre bestimmten Formen nach Zahl und Gestalt.« (Tim 51a7-b5)
(Siehe hierzu Benjamin Gleede Platon und Aristoteles in der Kosmologie des Proklos, Tübingen 2009, zu Argument XIV)
Gödels Kritik an Hegels Anfang der Wissenschaft der Logik
Gödel hat Hegel intensiv studiert, jedoch sind von ihm nur wenige Kommentare zu Hegel bekannt. In mancher Hinsicht ging Hegel für ihn sogar weiter als Leibniz (Wang, S. 310), doch hielt er ihm mangelnde Klarheit, fehlende »meaningful predication« und die Unfähigkeit vor, komplexe Begriffe aus einfachen Begriffen zu entwickeln (Wang, S. 232, 312-314). Abgesehen von diesen formalen und methodischen Fragen kritisierte er, wie Hegel die Wissenschaft der Logik anfängt.
Am Anfang steht für Gödel der Übergang vom Möglichen zum Wirklichen und nicht das Werden als Synthesis aus Sein und Nichts. Auch das Mögliche hat für ihn Sein. Insofern stimmt er Hegel zu, mit dem Sein zu beginnen. Aber er hält es für falsch, statt vom Möglichen wie Hegel vom Nichts zu sprechen. Das Mögliche ist mehr als Nichts. Nach seinem Eindruck hat Hegel entgegegen der eigenen inneren Logik seines Denkens mit dem Begriff des Werdens implizit viel zu früh den Begriff der Zeit eingeführt
»9.4.10 Independently of Hegel's primitive terms [which begin with being, nothing and becoming], the process is not in time nor an analogy with history. It is right to begin with being, because we have to have something to talk about. But becoming should not come immediately after being and nothing: this is taking time too seriously. It is very clear that possibility is the synthesis between being and nothing. It is an essential an natural definition of possibility to take it as the synthesis of being and nothing. – Possibility is a weakened form of being.« (Wang, S. 313)
Dagegen versteht Gödel seine Philosophie als Monadologie im Sinne von Leibniz. Die Monaden liegen in einem Bereich des Möglichen vor Raum und Zeit, und mit ihnen lässt sich erklären, was in Raum und Zeit erscheint. Hegel geht umgekehrt vor. Er beginnt mit der Wirklichkeit und führt die Möglichkeit ein als das Ergebnis einer Reflexion, die an der Wirklichkeit die in ihr enthaltene Möglichkeit erkennt (Hegel, Wissenschaft der Logik, HW 6.208f).
Im Gegensatz zu Russell, Wittgenstein oder Popper teilt jedoch Gödel Hegels »dealing with contradictions. It is simply a systematic way of obtaining new concepts« (Wang, S. 313).
Gödels ontologischer Gottesbeweis
»In 1972 Gödel told me that his study of Leibniz had no influence on his own work except in the case of his ontological proof.« (Wang, S. 113)
Gödel war natürlich das Argument von Kant bekannt, dass der ontologische Gottesbeweis daran scheitere, die Existenz als ein Prädikat wie alle anderen Prädikate anzunehmen. Ich kann ein Geldstück mit noch so viel Prädikaten beschreiben (aus welchem Metall es gemacht ist, wie groß, alt, schwer es ist, welche Farbe es hat etc.), aber daraus ergibt sich nicht, ob es sich in meinem Besitz befindet (für mich existiert).
So weit ich den Gottesbeweis von Gödel verstehe, trifft für ihn Kants Kritik nicht zu, weil Kant Prädikate und Kategorien gleichsetzt. Der ontologische Gottesbeweis schließt aber nicht aus Kategorien des Seienden (Größe, Eigenschaft, Relation etc.) auf Gottes Existenz, sondern aus Werteigenschaften. Wenn es etwas Gutes gibt, und wenn alles danach bewertet werden kann, wie gut es ist, dann muss es eine Natur des Guten geben, woran das Gute gemessen werden kann. Der Existenz-Beweis schließt von der Gegebenheit von etwas Gutem auf die Existenz einer Natur des Guten. (Nach meinem Eindruck befindet sich Gödel mit diesem Gedanken in großer Nähe zu Hegel. Hegel versteht »die Prädikate gut, schlecht, wahr, schön, richtig usf.« als Urteile des Begriffs [HW 6.344] und entwickelt aus ihnen in mehreren Schritten die ihnen unterliegende Objektivität, mit der er Kants Kritik der Gottesbeweise widerlegen will [HW 6.402-406]).
Gödel spricht von Werten als »positive« und ihrer Verneinung als »negative«. An zentraler Stelle steht in seinem Beweis ein Axiom, dass etwas nur einen Wert haben kann, wenn dieser Wert seiner Natur entspricht (»because it follows from the nature of the property« (Gödel, CW 3, S. 403).
Menschlich gesprochen hat etwas keinen Wert, wenn es entgegen seiner eigenen Natur nur gut zu sein scheint, sich als gut darstellen kann.
Es mag dahingestellt bleiben, ob dies als Beweis anerkennt werden kann oder seinerseits eine Glaubensaussage ist. Aber mir scheint deutlich, dass ein Axiom dieser Art erforderlich ist, um die von Gödel gesuchte Gruppe von Axiomen der Mengenlehre und ihre Fruchtbarkeit zu finden. Daher scheint es mir kein Zufall zu sein, dass Gödel im gleichen Jahr 1970 sowohl seinen abschließenden Gottesbeweis wie die Manuskripte zur Kontinuum-Hypothese geschrieben hat.
Literatur
Mark van Atten: Monads and sets. On Gödel, Leibniz, and the reflection principle
in: G. Primiero and S. Rahman (Hg.): Judgement and Knowledge, London 2009, S. 3-33; Link
Mark van Atten, Juliette Kennedy: On the Philosophical Development of Kurt Gödel
in: Bulletin of Symbolic Logic, Volume 9, Number 4, Dec. 2003, S. 425-476; Link
Herbert Breger: Das Kontinuum bei Leibniz
in: L'Infinito in Leibniz. Hrsg.: Lessico Intellettuale Europeo. Rom 1990, S. 53-67; Link
Bernd Buldt, Eckehart Köhler u.a. (Hg.): Kurt Gödel, Wahrheit und Beweisbarkeit, Wien 2002, 2 Bd.
Rudolf Carnap: Logische Syntax der Sprache, Wien, New York 1968 [1934]
Gabriella Crocco: Gödel, Leibniz and “Russell's Mathematical Logic”
in: Ralf Krömer, Yannick Chin-Drian: New Essays on Leibniz Reception, Basel u.a. 2012, S. 217-256
Kurt Gödel: Collected Works, 5 Bd., Oxford 1986, 1990, 1995, 2003, 2003 (zitiert als CW)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke in 20 Bänden. Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu ediert. Red. E. Moldenhauer und K. M. Michel. Frankfurt/M. 1969-1971 (zitiert als HW); Link
Hans Heinz Holz: Leibniz, Darmstadt 2013
Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, 1. und 2. Auflage, Riga 1781 und 1787 (zitiert als KrV, A und B)
Eckehart Köhler (Köhler 2004): Ramsey and the Vienna Circle on Logicism
in: Maria Carla Galavotti (Hsg.): Cambridge and Vienna, Vienna Circle Yearbook 12, Springer 2004, S. 91-121
Eckehart Köhler (Köhler 2014): Gödel and Carnap, Platonism versus Conventionalism?
in: Galavotti, Nemeth & Stadler (Hg.): Philosophy of Science in Europe and the Vienna Heritage, Vienna Circle Yearbook 17, Springer 2014, S. 131-158
Gerd Laßner: Die Leibnizsche Monadologie aus der Sicht der modernen Naturwissenschaften
in: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät Band 30, Berlin 1999, S. 5-78; Link
Gottfried Wilhelm Leibniz (Leibniz 1996a, 1996b): Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Hamburg 1996, 2 Bd.
Gottfried Wilhelm Leibniz (Leibniz 1996c): Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, Hamburg 1996
Frank Linhard: Newtons "spirits" und der Leibnizsche Raum, Hildesheim 2008
José Ortega y Gasset: Der Prinzipienbegriff bei Leibniz und die Entwicklung der Deduktionstheorie, München 1966
Tanchisa Otabe: Der Begriff der "petites perceptions" von Leibniz als Grundlage für die Entstehung der Ästhetik
in: Journal of the Faculty of Letters, the University of Tokyo, Aesthetics. 35, 2010, pp. 41-53; Link
Claudio Ternullo: Gödel's Cantorianism
in: Eva-Maria Engelen, Gabriella Crocco (Hg.): Kurt Gödel: Philosopher-Scientist, Aix en Provence 2015, S. 417-446
Walter Tydecks: synecheia – der aristotelische Begriff des Continuums, Bensheim 2014
unter: http://www.tydecks.info/online/aristoteles_metamathematik_continuum.html
Hao Wang: A logical Journey, from Gödel to Philosophy, Cambride, Massachusetts 1996
Palle Yourgrau: Gödel, Einstein und die Folgen, München 2005
2016
© tydecks.info 2016