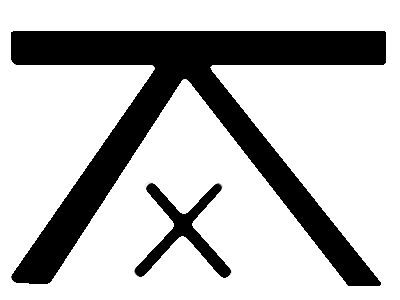Walter Tydecks
Beethoven: Klaviersonate Nr. 32 in c-Moll op. 111
- Interpretationen
Erzählungen von Lebenskrisen (Yudina, Richter, Sofronitsky, Grinberg, Nat, Guller)
Frühere deutsche Interpreten (Gieseking, Kempff, Backhaus, Arrau)
Zusammenspiel von unbewachter Spontaneität und objektiver Disziplin (Glenn Gould, 1956)
Vorsichtiger Aufbruch 1947 - 1965 (Benedetti Michelangeli, 1961)
Musik der Globalisierung und des Jet Set (Serkin, Pollini)
Gesang aus weitem Herzen (Tatiana Nikolayeva, 1987)
Wildes Geschrei der Vögel (Benedetti Michelangeli, 1990)
Momente von Versenkung (Uchida, 2005)
Den Weg zu einem romantischen Spiel wieder geöffnet (Andras Schiff, 2007)
'Weitermachen' auch in 'wüsten Zeiten' (Volodin, 2004)
Vollständige Desintegration bis zum jähen Ende (Soldan, 2013)
Erzählungen von Lebenskrisen
Beethoven hat seine Klaviersonaten als Erzählungen verstanden und sich über die Hörer gewundert, die hier "nur" Musik sahen. Große Interpretationen meistern daher nicht nur die Technik, sondern können mit ihrem Spiel "etwas sagen". Das ist für mich bei weiter zurückliegenden Aufnahmen leichter zu verstehen als bei aktuellen, zu denen die Distanz möglicherweise fehlt. (Ich gehe bewusst das Risiko ein, dass dies möglicherweise subjektiv und spekulativ ist und an dem vorbeigeht, was sich die Interpreten seinerzeit dabei gedacht haben. Zahlreiche Hinweise auf mir unbekannte Aufnahmen verdanke ich Frank Georg Bechyna und dem ihm zugänglichen Material des im Sommer 2008 überraschend verstorbenen Manfred Voss.)
Es soll daher weniger um Formanalyse gehen und mit welchen technischen Mitteln und Entscheidungen die Interpreten das Werk bewältigt haben. Wer daran interessiert ist, dem sei Jürgen Uhde "Beethovens Klaviermusik", Bd. 3 empfohlen, und natürlich das bahnbrechende Werk von Heinrich Schenker "Die letzten fünf Sonaten von Beethoven". Joanna Goldstein hat eine exemplarische Analyse der Aufnahmen von Alfred Brendel, Arturo Benedetti-Michelangeli und Vladimir Ashkenazy geliefert.
Maria Yudina (1899-1970), Kommilitonin von Schostakowitsch und Sofronitsky in St. Petersburg, befreundet mit Pasternak, Mandelstam und später Boulez und Stockhausen, unterrichtete in St. Petersburg und auf Wunsch von Neuhaus in Moskau. Einzigartige Mischung von tiefer Religiosität und Offenheit für zeitgenössische Musik. Zeitweise verbannt, obwohl Stalin ihre harte und kompromißlose Art zu spielen liebte. Lesenswert ihre Erinnerungen an "Vovochka" Sofronitsky, die auch viel über sie selbst sagen. Wie nimmt sie diese Sonate: Die Tempi der Aufnahme vom 25. Juli 1951 sind extrem. 9'13'' und 13'43''. Der erste Satz ist äußert hart, fast statisch, als steht da ein stalinistisches Beethoven-Monument aus Stahl, das für die Ewigkeit gemeißelt ist. Eine ganz ungewöhnliche Beschleunigung im 2. Satz (2:22) reißt jedoch mit der 1. Variation mitten hinein in die Dynamik eines religiösen Ergriffen-Seins. Wenn von Ekstase in der Musik gesprochen werden kann, dann hier. Wunderschön, wie nach den großen Steigerungen der 3. Variation in der Mitte des Satzes der "Rückfall" in die alltägliche Arietta mißlingt (6:58), und das Spiel im weiteren wie gefangen bleibt von einem Feuer, das aus dem Jenseits lodert. Wie in tiefster Erschöpfung ein abrupter Abbruch.
Nichts von Ekstase ist in der völlig anderen Interpretation durch Svjatoslav Richter (1915-1997, Neuhaus-Schüler, der weitere Werdegang dürfte allgemein bekannt sein) am 28. November 1963 in Leipzig zu hören, dennoch ebenfalls eine äußerst mitreißende, aufwühlende Aufnahme mit ganz eigenem Feuer. Sie gehört zweifellos zu den Sternstunden, zu denen Richter immer wieder fähig war. Nie sonst wird der 1. Satz mit einer solchen Erregung gespielt. Das beginnt mit dem ersten Takt. Der 2. Satz scheint einen Moment lang den "besänftigten Willen" zu zeigen, von dem Wagner sprach, doch ohne je richtig Atem holen zu können ist sofort die innere Unruhe wieder zu spüren. Das ist wie "zum aus die Haut fahren". Ich kenne nur wenige Aufnahmen, die eine derartige subjektive Intensität zeigen. Je weiter sich die Variationen steigern (spätestens ab 6:14), wird immer deutlicher, dass es um nicht weniger als die Vergeblichkeit des Irdischen geht. Anders läßt sich diese Interpretation, die den Hörer ratlos und innerlich restlos entleert zurückläßt, nicht charakterisieren. Richter hat damit ohne Zweifel einen Grundzug getroffen, den Beethoven in dieses Werk hineingelegt hat.
Dass es möglich ist, das gleiche Stück ebenso überzeugend geradezu entgegengesetzt zu spielen, zeigt Vladimir Sofronitsky (1901-1961) in seiner Live-Aufnahme vom 3. Feb. 1952 in Moskau. Der erste Satz wird ungewöhnlich schnell gespielt (6'40'', allerdings lässt er die Wiederholung weg). Nur Richter spielt 1963 in Leipzig mit vergleichbarem Drive. Hier ist es der Auftakt für einen 2. Satz, in dem er einen Beethoven spielt, dem eine andachtartige Versenkung gelingt. Während bei Yudina eine religiöse Erscheinung zu hören ist, die den Komponisten und die Interpretin ergriffen hat, beschreibt Sofronitsky eine Zwiesprache des Komponisten mit der Musik und - wenn das so gesagt werden darf - dem Göttlichen in der Musik. Er beschreibt einen gelingenden Rückzug in das Dunkle und das Geheimnis der Zeit. Die Musik antwortet geradezu auf den Komponisten. Das ist erstmals (7:40) zu hören am Ende der großen Steigerung durch die 3. Variation, wenn erst zaghaft und dann immer deutlicher zu vernehmen eine ferne Stimme antwortet, die kaum von der inneren Stimme zu unterscheiden ist und sich aus dieser Antwort der Umschlag in den zweiten Teil des Satzes ergibt. Die Triller sind interpretiert als der Widerhall, wenn der Komponist etwas ihm ganz Fremdes und Fernes hört, und diesen Moment dennoch festhalten kann. Das ist für mich neben Yves Nat die bei weitem optimistischste und bei jedem Hören neue Kraft verleihende Einspielung dieser einzigartigen Sonate.
Aber auch damit ist noch längst nicht das letzte Wort gesprochen. Maria Grinberg (1908-1978, ihr Mann und ihr Vater wurden 1937 als "Staatsfeinde" hingerichtet, sie konnte jedoch überall in der Sowjetunion Konzerte geben, im Ausland trat sie nur zweimal in den Niederlanden auf). Diese Aufnahme entstand 1967. Anfangs fiel mir nur der zurückhaltende, etwas traurige Ton auf, bis mich die Einspielung immer mehr für sich einnahm. Wie schön, nach den aufwühlenden Aufnahmen durch Sofronitsky, Yudina, Richter oder Guller wieder eine solche Interpretation zu hören. Einmal habe ich im ersten Satz auf die Zeitanzeige geschaut: 5:54 spielt sie das kleine Fugato mit einem solchen Ausdruck von Sorge und Mitgefühl, ich kann es nicht anders in Worte fassen. Und die deutlichen Steigerungen klingen bei ihr nicht wie Kampf bis zur Selbstvernichtung, sondern ein ungeschminktes Bewusstsein über den Ernst einer schwierigen Lage, die mit keinem Ausdruck geschönt wird, aber auch nicht verzweifeln lässt. Der übergangslos anschließende 2. Satz ist für meine Ohren ein einziger Zuspruch für jemanden, dem es unverschuldet ganz schlecht geht, und den sie trösten und wieder aufrichten will. Ich denke hier am ehesten an die Zuneigung einer Mutter zu ihrem Sohn, es kann aber auch eine Schwester zum Bruder oder eine Frau zum Mann sein, eine Tochter zum Vater. Das führt bisweilen (z.B. ab 2:42) zu einer Leichtfüßigkeit, wie ich sie sonst in diesem Satz nie gehört habe, und das nicht aus dem Versuch der Verharmlosung oder Verdrängung, sondern der Aufmunterung, Stützung und Bestätigung. Ihr scheint eine Beruhigung und innere Stärkung des geliebten Gegenüber zu gelingen. Die hohen Töne und Triller klingen nicht kalt wie ferne Sterne, sondern wie umfangende Blicke großen Wohlwollens. Zum Schluss wendet sich die Musik nach innen in ein wiederholendes Selbstgespräch (etwa ab 12:20), in dem sie sich noch einmal die tiefe innere gegenseitige Verbundenheit vergegenwärtigt und das Mitgefühl immer wieder von neuem durchtönt. In keiner anderen Aufnahme ist der Schluss des Satzes so arglos und selbstverständlich.
Welch berstende Kraft im 1. Satz steckt, das ist bei Yves Nat (1890-1956) in seiner Aufnahme von 1954 zu hören. (Er hatte sich nach großen Erfolgen zwischen den Weltkriegen 15 Jahre aus dem Konzertleben zurückgezogen und wurde 1953 bei seiner Rückkehr in Paris wie ein alt gewordener "Löwe" begrüßt und begeisterte mit der Aufnahme aller Beethoven-Sonaten.) Er nimmt diesen Satz nicht nur äußerst schnell (6'20'', jedoch wie Sofronitsky ohne Wiederholung), sondern vermag in diesem Tempo ein Maximum an Energie freizusetzen, das dennoch nie gehetzt wirkt. Aber diese Kraft kann sich nicht frei entfalten. Sie findet keinen Widerstand und stößt gewissermaßen ins Leere. Hier kämpft kein Unterliegender gegen das Schicksal, wie Richard Wagner, Paul Bekker und Uhde deuten, sondern Beethoven sieht sich in einem unwirklichen Raum, wo ihm alle Betätigungsfelder, Angreifpunkte und Erfolgsmöglichkeiten für seine Kraft genommen sind. Er spürte, wie er mit seinem öffentlich geäußerten Unbehagen an den Zuständen unter Metternich nach 1815 allein blieb und nur verschont wurde, weil er so berühmt war. Das trieb ihn in große Einsamkeit, in der er alle seine Lebensziele und die sie beflügelnden Motive zerrinnen sah. Das höre ich so deutlich nur bei Yves Nat. Beethoven verfällt aber weder in eine Depression noch in sinnlose Versuche, die innere Energie auszutoben und abzureagieren, sondern das Spiel schlägt unvermittelt (5:55) in die kurze, ruhige Schlussphase um. Es bleibt der einzige Moment, wo in dieser Aufnahme eine kurze Ruhepause gegönnt ist. Bei den Variationen der Arietta erwacht sofort wieder das innere Leben und treibt weiter. Anders als bei Richter ist aber keine Vergeblichkeit zu hören, sondern der Wille zu etwas Neuem (typisch z.B. 6:10). Auch hier widerspricht Nat der Deutung von Wagner, der in diesem Satz den "besänftigten Willen" sah. Stattdessen zeigt er einen Beethoven, dessen kreative Fähigkeit weiterlebt. Diese Sonate ist bei ihm ein einzigartiger Durchgangspunkt zu etwas noch nicht Gehörtem. Beethoven wird die Klaviersonate verlassen und es ist bereits zu hören, wie er in diesem Moment des Rückzugs die neuen Klänge findet, die dann in den Diabelli-Variationen ausgearbeitet werden, deren erste Teile zur gleichen Zeit entstanden wie diese Sonate.
Als letzte Interpretin soll Youra Guller (1895-1980) genannt werden. (Sie kam schon früh aus Rumänien nach Paris, bewegte sich dort in der Avantgarde, durchlebte auch persönlich alle Höhen und Tiefen dieser zerrissenen Zeit, feierte in den 1960ern ein Comeback, diese Aufnahme entstand erst sehr spät 1973). Mit fast 80 Jahren versucht sie nicht, sich mit jüngeren Interpreten oder dem eigenen früheren Können zu messen. Sie wählt ein vorsichtiges Tempo (10'24'', 18'34'') mit entsprechendem Anschlag. Darüber gelingt ihr jedoch eine ganz ungewöhnliche Intensität, die den Atem stocken läßt. Jeder einzelne Klang ist ausgehört, keine Dissonanz überspielt. Wie viel wird im ersten Satz begonnen und nicht ausgeführt, allein die zahlreichen Fugati. Neben- und Hauptstimme durchkreuzen einander oft. (In seiner flapsigen Art konnte Gould 1956 sagen, dieser Satz sei missraten und so schlecht, dass er möglichst schnell den 2. Satz erreichen wollte. Joanna Goldstein hat bei Michelangeli in diesem kurzen Satz nicht weniger als 47 Tempowechsel nachgewiesen.) Bei Guller ist zu hören, wie all der Schmerz ihres eigenen Lebens wiederkehrt und sich nicht vergessen läßt. Im 2. Satz wandelt sich der Rückblick stufenweise. Wie durch einen Tränenschleier (1:43) tauchen die Erinnerungen auf, bis sie sich schließlich selbst sieht als das kleine Mädchen in früher Kindheit, im Hintergrund das Echo der Stimme der früh verlorenen Mutter (11:04). Hat das Leben halten können, was damals offen und voller Erwartung wie eine Versprechung vor ihr lag?
Frühere deutsche Interpreten
Die früheren deutschen Interpreten folgen mehr oder weniger stark der Deutung durch Wagner, Hans von Bülow, Liszt und Paul Bekker, auch wenn sie dann jeweils ganz unterschiedliche Wege der Interpretation wählen. Das gilt auch für Solomon Cutner (1902-1988, der Schüler von Mathilde Verne war, einer Clara Schumann Schülerin) und Claudio Arrau, der schon 1913 nach Berlin gekommen war. In Deutschland blieb diese Richtung nach 1945 noch lange Zeit vorherrschend. International setzte sich aber bald die klassizistische Gegenrichtung durch, die ursprünglich von Pianisten wie Artur Schnabel und Rudolf Serkin begründet wurde, die Deutschland verlassen mussten. Die nachfolgende deutsche Pianistengeneration schloss sich dem globalen Trend an, so dass nun die früheren deutschen Interpreten recht isoliert da stehen. Erst mit über 50 Jahren Verspätung sehen sie sich jetzt zusätzlich der Kritik für ihre politische Haltung nach 1933 ausgesetzt, nachdem ihr Stil längst aufgegeben wurde und es inzwischen umgekehrt an der Zeit ist, in einer neuen Gegenbewegung das technisch orientierte Spiel in Frage zu stellen.
Walter Gieseking (1895-1956). Früher Vertreter des "modernen" am Notentext orientierten Klavierspiels ohne viel Pedal und ohne eine überladene und missverstandene Romantik. Erarbeitete sich Werke rein durch mentales Studium und übte nur wenig am Klavier. Setzte sich für zeitgenössische Komponisten ein, insbesondere Debussy und Ravel. Unterschied sich daher stark von den in Deutschland zu seiner Zeit üblichen Beethoven-Interpretationen. Spielte die letzten 3 Sonaten 1937 bis 1949 ein. Übergreifendes Konzept der Sonaten-Trias: op. 109 und 110 überraschend zurückhaltend, weit weniger dramatisch als z.B. Maria Grinberg. Betont in op. 109 den Charakter eines Kinderliedes. Sehr ruhig die Fuge in op. 110. Die Schlussphase mit den Sforzati kommt dann aber um so kräftiger und markiert einen echten Umschlag. Ich habe diese Stelle bisher noch nie so gemeistert gehört. Dieser neue Ton geht direkt über in den 1. Satz von op. 111. Gieseking spielt äußerst schnell, wenn auch ohne Wiederholung. Die Fugati klingen daher schon fast wie die Trillerketten im 2. Satz. Auch dieser Satz ist im Vergleich zu anderen Aufnahmen sehr schnell und geradezu innerlich erregt gespielt. Die gesamte Sonate op. 111 bekommt die Aufgabe, den extremen Ausbruch am Ende von op. 110 zu verarbeiten und wieder ein wenig zu beruhigen.
Wilhelm Kempff (1895-1991). Wie eine königliche Hoheit unter den Pianisten, immer auf der Sonnenseite, immer ein fürstlicher Lebensstil. Hier geht es um seine Einspielung 1953-54. Ihm liegt besonders op. 109. Die Sonate ist Maximiliane Brentano (1802-1861) gewidmet, die mit ihrer Mutter Antonie 1810 in Wien war, wo Beethoven sie kennen lernte. Bei Kempff ist sie kein kleines Mädchen mehr, sondern eine junge Dame. Er bereitet ihr in den Variationen des 3. Satzes einen großen Auftritt, bei dem sie voller Anmut noch Kindlichkeit bewahrt, sich aber bereits ernst und selbstsicher unter Erwachsenen bewegen kann, ihre eigene Weltsicht entwickelt und von der Eleganz und Wirkung ihres Erscheinens weiß. Kempff genießt die Gegenwart einer solchen jungen Schönheit, auch wenn er ihren Liebreiz höher zu schätzen scheint als die sich entwickelnde Persönlichkeit. Dennoch, dieser Satz gefällt mir bei jedem neuen Hören besser.
Die Sonate op. 110 und der 1. Satz von op. 111 kommen seinem Klavierspiel weniger entgegen. Der 2. Satz von op. 110 ist seltsam verzögert. Dadurch gewinnt zwar das Trio einen ungewohnten Charakter, aber das bäurisch-Derbe mit seinem auffahrenden Unterton gehört offenbar nicht in seine Welt. Doch mit der 2. Variation im 2. Satz von op. 111 findet er zurück. Da zeigt er die Delikatesse, der er fähig ist. (Es klingt, wie wenn auf der Orgel ganz neue Register gezogen werden. Sein Vater war Organist und hat ihm früh das Orgelspiel beigebracht.) In seinem Spiel der Trillerketten leuchtet die Scheinwelt auf, von der Thomas Mann im "Doktor Faustus" gesprochen hat: Hier erscheint ein künstliches "Azurblau", ein "Himmelsbau" durch "eine Kleinstruktur, die es durch künstliche Brechung der Lichtstrahlen und Ausschaltung der meisten besorge". Was Thomas Mann am Beispiel exotischer Schmetterlinge schreibt, das ist hier in Musik zu hören. Kempff entwickelt eine klingende Farbenpracht, bei der nicht mehr zu unterscheiden ist, was Schein ist und was nicht.
Wilhelm Backhaus (1884-1969). Gilt trotz seiner Bekenntnisse während der NS-Zeit lange, teilweise auch heute, als der maßgebliche Beethoven-Pianist. Ich vermute stark, dass Gould vor allem seine Beethoven-Auffassung parodieren wollte. In seinem Konzert vom März 1954 in New York stellt er die Sonate op. 111 an den Schluss eines großen Beethoven-Abends, der mit der Pathétique beginnt und über die Sturm- , op. 79 und Abschieds-Sonate zu diesem Spätwerk führt. Die Auswahl könnte kaum besser sein. Ganz anders als Kempff spielt Backhaus eher statisch, voller Kraftanstrengung. Wie mit Ausrufezeichen werden nach vielen Melodiebögen und Steigerungssequenzen Schlusspunkte gesetzt, selbst bei einigen Trillerketten. Das hemmt schon ein wenig den letzten Satz der Pathétique und zeigt sich besonders in der Sturm-Sonate. Obwohl Tempo und Anschlag sehr überzeugend gewählt sind, bleibt selbst die wunderschöne Nebenmelodie des 1. Satzes erdverhaftet und gewinnt keine Bewegungsfreiheit wie etwa bei Yves Nat.
Backhaus will sein Beethoven-Bild zeigen und sich mit ihm identifizieren. Das gelingt am besten in op. 81a und dort besonders im langsamen Satz. Hier passt Backhaus' Spiel genau zu Beethovens Anliegen, der eine Stockung und innere Aufballung der Kräfte zeigen will. Der letzte Satz ist dann keine überschwängliche Freude über die Wiederkehr, sondern hier beginnt das Spiel geradezu gegen den Strom zu schwimmen, wird sich der äußeren Widerstandskräfte bewusst und kämpft dagegen an. Es bleibt aber im Ganzen noch optimistisch und erfolgssicher. Ich bevorzuge eine andere Deutung dieser Sonate, halte aber Backhaus' Entscheidung für eine nachdenkenswerte Alternative.
Im 1. Satz von op. 111 beginnen die äußeren Gegenkräfte endgültig zu überwiegen. Mit jedem Fugato verdunkelt sich der Grimm über die Welt. Dank seiner überragenden pianistischen Fähigkeiten gelingt es Backhaus, eine Verschließung oder Erstarrung zu vermeiden und das innere Gefühl der Wut und Ohnmacht über alle Grenzen weiter zu steigern, bis es (5:43) zu einem letzten Befreiungsversuch kommt, der in extrem harten Schlägen untergeht (6:06). Da klingt Beethoven wie von Gustav Mahler aus gesehen, etwa dem 1. Satz aus dessen 2. Sinfonie. Der Ausklang des 1. Satzes endet zwar notentreu in C-Dur, aber ohne rechte Aufhellung, sondern mit einem vom Pedal bis zum Beginn des 2. Satzes lange gehaltenen tiefen Ton und bekommt dadurch etwas sehr Schweres.
Nach einem solchen Satz können die Arietta-Variationen keine Beruhigung und Gelassenheit geben. Das Thema wird mit einer inneren Spannung gespielt, die schier zu bersten droht und sich regelrecht hineinstürzt in die sog-artige Bewegtheit der ersten 3 Variationen. Bei aller Äußerung größter Kraft gelingt am Ende der 3. Variation kein klarer Einschnitt, sondern wie ausgelaugt geht es weiter in die 4. Variation. Auch dort findet das Spiel keine Ruhe. Backhaus hält - anders als die meisten Interpreten den Anweisungen von Beethoven folgend - das hohe Tempo bei. Die Triller der kleinen Episode gehen unter die Haut scharf wie Messer (9:09) und nochmals spannen sich alle Kräfte zusammen in eine letzte Aufladung (11:13), bis endlich dieser Schrecken ein Ende findet.
Von dieser Aufnahme geht eine ähnliche Faszination aus wie von manchen Einspielungen Furtwänglers. Sie muß zur Deutung dieser Sonate herangezogen werden. Das Schlimmste, was geschehen konnte, war, darüber wortlos hinwegzugehen und anschließend in einer Gegenbewegung einfach zu versuchen, überhaupt jede Gefühlsregung in der Musik zu unterdrücken. So kann der Geist, den Backhaus einzigartig zu gestalten vermochte, unverarbeitet wie ein böses Erbe im Unbewußten weiter leben.
Claudio Arrau (1903-1991). Stammte aus Chile, studierte ab 1913 in Berlin, emigrierte 1940-41 in die USA. Er kann daher sicher auch zu den deutschen Pianisten gezählt werden. Mit ihm ist ein erstes Resume möglich. Die deutschen Pianisten stehen voller Ehrfurcht vor Beethoven und wagen weit weniger ein subjektives Spiel als etwa Guller, Richter oder Grinberg. Darunter leidet besonders der 1. Satz, auch bei Arrau. Hier ist noch einmal alles erinnert, was von den anderen großen c-Moll-Stücken bekannt ist, der Pathétique-Sonate, Coriolon-Ouvertüre und 5. Sinfonie. Das Spiel gewinnt keine Individualität. Das gilt auch noch für das Arietta-Thema und die ersten Variationen.
Erst mit der zweiten Hälfte des 2. Satzes findet Arrau zu einem eigenen Stil. Die über viele Takte hinweg wiederholten Noten sind wie hingetupft, und es entsteht eine ganz eigentümliche Klang- und Lichtwelt, die so bei keiner anderen Aufnahme zu hören ist. Allein deswegen ist diese Interpretation unbedingt zu empfehlen. Mich erinnert das an die Bilder von Kupka, die sehr gut die von Beethoven in dieser Sonate erreichte Unanschaulichkeit in Farbe bringen. Auch der Titel einer "amorphen Fuge" trifft sehr gut.
Zusammenspiel von unbewachter Spontaneität und objektiver Disziplin (Glenn Gould, 1956)
1956 spielte Glenn Gould nach seinem überwältigen Erfolg mit den Goldberg-Variationen die letzten 3 Beethoven-Sonaten ein. Stegemann berichtet, dass er sie zum erstenmal gespielt hat, "als er vom Tod Thomas Manns (am 12. August 1955 in Zürich) erfuhr. - Hommage an den Adrian Leverkühn." (Stegemann, S. 108) In Deutschland macht man sich oft nicht klar, wie stark das Ansehen der deutschen Musik ("Teutonismus") im Ausland gelitten hatte. Gould versuchte auf seine Weise mit einer Neu-Entdeckung von Bach und Beethoven eine Rehabilitation. Entsprechend enttäuscht war er, als dies nicht wahrgenommen und seine Beethoven-Einspielung von der Kritik zerrissen wurde ("kindisch", "oberflächlich, reißerisch", "inakzeptabel").
In einem Essay und verschiedenen Briefen hat er seine Auffassung erläutert. Er will sich vom überlieferten Beethoven-Mythos trennen, den er auch bei Thomas Mann ("Doktor Faustus") und Aldous Huxley ("Kontrapunkt des Lebens", 1928) fortgeführt sieht. Für ihn zeigen die Sonaten op. 109 - 111 "jenes Zusammenspiel von unbewachter Spontaneität und objektiver Disziplin, die das Kennzeichen seines Spätwerkes ist". Das begann mit der "motivischen Komprimiertheit der Siebenten Sinfonie, die Sonate op. 101, durch die harmonische Unverblümtheit der Achten Sinfonie, die kraftvolle Kantigkeit der Sonate op. 81a" und ist ganz das Gegenteil der sonst behaupteten "apokalyptischen Offenbarungen". Er will spielen, wie "sie uns trägt in ein Reich solch seligen Glücks". (Gould 1956 in seinem Essay "Beethovens letzte drei Klaviersonaten", zitiert nach "Schriften 1", S. 91f)
Diese Beethoven-Auffassung zeigt Gould bereits beim Spiel früher Werke, so bei der Kadenz am Ende des 1. Satzes des 2. Klavierkonzerts. Welch eine Leichtigkeit und Spielfreude. Bei den 3 späten Sonaten unterscheidet sich in diesem Sinn vor allem op. 110 von anderen Aufnahmen. Nirgends sonst sind im 2. Satz die beiden Gassenhauer so getroffen wie hier, und dann das völlig anders als sonst gespielte kurze Trio. Der tieftraurige 3. Satz von op. 110 zeigt nicht den "Titanen". Die zurückkehrende Lebendigkeit im Schlussteil mit der Fugen Umkehrung ist herrlich getroffen, und führt dann voller Schmerz und Anstrengung in die sich überschlagenden letzten Sforzati, den Weg öffnend nach op. 111.
Warum hat Gould im 1. Satz von op. 111 das "Allegro con brio e appasionato" so extrem schnell gespielt? Ich vermute, er wollte damit die ursprüngliche Bedeutung der Fuge als Flucht zeigen. Das ist extrem, aber es gelingt dadurch ein wunderschöner Schluss des Satzes. Vielleicht ist es auch als Beispiel zu verstehen, mit diesem Tempo das Chaotische der "unbewachten Spontaneität" zu zeigen, die sich mit der "objektiven Disziplin" der Fugati verbindet. Gould zeigt einen Beethoven, der sich von allen sozialen und künstlerischen Zwängen befreit hat. In der Abwehr gegen Gould wiederholt sich viel von der ursprünglichen Ablehnung Beethovens. Gould hält sich nicht mehr an die lange Tradition, die Beethoven für den vorherrschenden bürgerlichen Kunstgeschmack zurechtgebogen hat.
Die Arietta ist von Anfang bis Ende eine wunderschöne Melodie. Die Triller zeigen reine Spielfreude. Statt starrer oder erstarrter Trillerketten haben sie bei Gould etwas Tänzerisches, das in jeder Wiederholung einen neuen Charakter gewinnt. Er zeigt, wie es klingt, wenn die 4. Variation nicht entgegen den Vorgaben von Beethoven im Tempo extrem zurückgenommen wird.
Mit der Ablehnung seiner Interpretation wurde ein Chance vertan. Gould ist sicher kein typischer Beethoven-Interpret, aber sein außergewöhnliches Rhythmus-Gefühl hat eine Interpretation ermöglicht, die einzigartig ist und eine völlig andere Seite dieses Werks zeigt. Was für die weitere Geschichte der Beethoven-Interpretation möglich gewesen wäre, zeigt vielleicht besser ein Bild:
Vorsichtiger Aufbruch 1947 - 1965 (Benedetti Michelangeli, 1961)
Wie konnten Pianisten auf die neue Realität nach 1945 reagieren? Während in Deutschland alle altbekannten Namen weiter die Konzertsäle dominierten, als wäre nichts geschehen, sich von den USA aus ein rein technisches Virtuosentum durchsetzte und die sowjetische Pianistenschule im Westen wegen Ausreiseverboten weitgehend unbekannt blieb, suchte in Frankreich und Italien eine neue Generation andere Wege. Das sind zum Beispiel Alexis Weissenberg (geb. 1929), Samson Pascal François (1924 - 1970), György Cziffra (1921-1994), Dinu Lipatti (1917-1950) und natürlich Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995).
Ihre Klavierkunst hatte Weissenberg und Benedetti Michelangeli in äußerst bedrohlichen Situationen während der letzten Kriegsjahre das Überleben gesichert. Sie entdeckten einen neuen Chopin, sahen ihr eigenes Lebensgefühl in der inneren Erregtheit seiner Klavierstücke widergespiegelt. Viele hatten sich aus Osteuropa nach Paris gerettet und konnten sich in Chopin wiedererkennen, der 1830 aus Polen nach Paris fliehen musste. Ihm wurde alles Süßliche genommen, eine Abkehr vom "nahezu unverrückbaren Chopin - Salon - George Sand - Vorurteilsbild" (Frank in einer E-Mail). Beethoven blieb ihnen aber schwierig aufgrund seiner immensen Bedeutung für das deutsche Weltbild, das zum Nationalsozialismus und zwei Weltkriegen geführt hatte.
Ihr großes Vorbild aus dem deutschen Kulturraum war Artur Schnabel. So bildeten sich zwei Richtungen, die Schüler von Edwin Fischer (u.a. Badura-Skoda, Barenboim, Brendel, Demus, Hansen, Grete Sultan) und die von Schnabel (u.a. Clifford Curzon, Claude Frank, Dinu Lipatti, Leon Fleisher).
Nur Benedetti Michelangeli wagte sich früh an Beethoven und dessen opus 111. Seine Einspielung von 1961 (BBC, London) ist passenderweise mit Chopins b-Moll Sonate (1959) zusammengestellt. Diese außergewöhnliche Chopin-Aufnahme soll hier nicht besprochen werden, aber von dort ist "sein" Beethoven zu verstehen: Zurückhaltung bei den Lautstärkeunterschieden und den Sforzati, stattdessen mehr Gewicht und größte Deutlichkeit auf die Feinheiten und Binnenstruktur. Bis ins letzte Detail sind die rhythmischen Wechsel und Brüche ausgearbeitet, so dass eine äußerst dichte Aufnahme entsteht. Das Spiel ist immer und überall wie von zahlreichen Seiten zugleich gesehen.
Wenn Backhaus häufig in den kleinen Melodiebögen auf einen bestimmenden Schlusspunkt drängt und das Werk bisweilen fast Parolen-Charakter bekommt, betont Benedetti Michelangeli oft den Anfangston. Besonders deutlich am Ende des 2. Satzes (ab ca. 13:35), aber auch bei den sich wiederholenden Einsätzen in den Fugati des 1. Satzes. Dadurch entsteht immer wieder etwas Neues. Das Spiel hält ständig Überraschungen bereit. Mal scheint es, als wird der Spieler von außen angestoßen in eine andere Richtung, dann wieder ergreift er selbst die Initiative. Ein echter Dialog, ein wunderschönes Beispiel für Aufnahmebereitschaft, Hinhören und eigenen Einsatz. Im 1. Satz gelingt daher sowohl im Kleinen wie im Großen der Bogen von den gewaltigen Schlägen des Maestoso bis zum stillen Ausklang in C-Dur.
Der Techniker Benedetti Michelangeli achtete bekanntlich auf alles. Die vom Pedal angestoßenen Schwingungen bekommen bei ihm eine eigene Bedeutung. Hier ist seine Organistenausbildung zu erkennen. Das Pedal klingt nicht wie ein anhaltender, in die Länge gezogener Klang, bisweilen wie ein bedrohlicher Schatten, sondern erreicht eine eigene Schwebung. Manchmal kommt es fast zu Wechselwirkungen mit dem Spiel der Melodie und ihrer Begleitung. Das ist besonders deutlich beim Thema im 2. Satz. Vom Pedal klingt der lange Nachhall am Ende des 1. Satzes immer neu nach. Das könnte bei einem anderen Pianisten eine depressive Fixierung auf das Vergangene erzeugen, doch hier ist es das Aushalten eines langen Ruhemoments, bevor dann mit der 1. Variation nicht nur der Rhythmus wechselt, sondern auch der düstere Ton wie abgeworfen ist. Im Gegenzug dann im 2. Teil des 2. Satzes der äußerst reine, harte Klang der hohen Töne. Das erzeugt im Ganzen eine ungeheure Spannung, in deren Mitte der 2. Teil der 3. Variation steht, bei der er mit der linken Hand einen sehr harten Takt schlägt, der vorgibt, was sich dann in den hohen Lagen wiederholen wird.
Eine Anekdote sagt, dass nach seinem intensiven Üben von op. 111 sogar die Vögel in seinem Garten Beethoven mitpfiffen. Ich verstehe es anders: Benedetti Michelangeli verehrte das Franziskanertum und predigte mit seinem Spiel wie der heilige Fanziskus den Vögeln. Er achtete sehr genau darauf, wie sie sein Spiel annahmen. Im Wechselgesang mit ihnen fand er eine Beseeligung, die ihm unter den Menschen in den meisten Fällen verweigert wurde. Eine Ausnahme waren seine Unterrichtsstunden, solange er sie aus den Einnahmen von seinen Konzerten unentgeltlich erteilen konnte, aber auch diese Freude wurde ihm von Missgönnern viel zu früh genommen.
Die kurze Phase 1947 - 1965 ist eingeschlossen von den aufwühlenderen Zeiten davor und danach, die bis heute weit größere Emotionen wachrufen. Da erscheint ein Spiel wie das von Benedetti Michelangeli fast wie ein Fremdkörper. Joachim Kaiser versteht ihn als "die ästhetisierendste Möglichkeit", Wolfgang Lempfrid wägt mit einem ironischen Ton die "Marotten eines klavierspielenden Exzentrikers" und "sein Streben nach pianistischer Perfektion und absolutem Schönklang" gegeneinander ab. Auch 'Romeo und Julia' hatten 2006 kommentiert: "sehr verhalten gespielt, sehr analytisch und trocken vorgetragen. Uns fehlt das singende und beseelte." Die Stärken von Benedetti Michelangeli liegen im Vergleich zu anderen ein wenig im Verborgenen. Da singt bisweilen jeder einzelne Ton, und dann ist wieder eine Härte zu hören, dass das Singen vergehen mag.
Musik der Globalisierung und des Jet Set
Seit den 1950ern dominieren Interpreten, die sich um einen allgemeingültigen, quasi objektiven, perfektionistischen Stil bemühen, der es allen Recht macht. Sie geben dafür naturgemäß ihre eigene Persönlichkeit so weit als möglich auf. Sie fühlen sich als Kosmopoliten. Wer ihre Veranstaltungskalender liest, sieht sie jedes Jahr mindestes einmal um den Erdball reisen. Jeder hat nach Möglichkeit sein eigenes Sommerfestival, am liebsten im Alpenraum, an einem kleinen See, oder irgendwo in Italien oder sonst einer schönen Landschaft. Es gibt keine nationalen Schulen mehr, sondern einen internationalen Einheitsstil. Tradition gilt nichts mehr. Uchida ist stolz auf drei Muttersprachen (japanisch, deutsch, englisch). Das Zentrum der Musik ist den Finanzzentren nach London und New York gefolgt. Manfred Voss hat es anläßlich der B-Dur Sonate von Schubert gegenüber Pollini auf den Punkt gebracht: "Auch Pollini (1986) verweigert uns eine Interpretation und spielt im wesentlichen nur sehr schön die Noten. Man erinnert sich an Richters Urteil, daß Pollini Schubert wie Prokofiev oder andere Komponisten des 20. Jahrhunderts spiele."
Diese Richtung ist nach 1945 in Amerika entstanden. Zu ihrer Entstehungsgeschichte gehört ein ebenso heikles Thema wie der Teutonismus: "Judentum und Modernität" (Titel des sehr empfehlenswerten Buches von Leon Botstein). Das Ideal einer objektiven, rationalen Musik bietet auf den ersten Blick all denen Schutz, die aufgrund ihrer von der Mehrheit abweichenden Kultur und Tradition verachtet und gedemütigt wurden. Das galt in hohem Maß für die Juden.
Im Europa des späten 19. und frühen 20. Jahrhundert misslang die Assimilation völlig. Aus Europa geflohen ergaben sich für sie in Amerika neue Möglichkeiten. Dort trafen sie auf die amerikanische Technikbegeisterung und das amerikanische Selbstbewußtsein, Amerika sei identisch mit der Welt (im Grundzug der verachteten teutonischen Haltung nicht unähnlich). Zugleich zeigte sich Amerika unfähig, die dort von den Minderheiten ausgehenden kulturellen Impulse zu integrieren (indianische Tradition, Blues, Jazz). Alle Bemühungen aus den 1930ern (etwa durch Aaron Copland oder Virgil Thomson) wurden nach 1945 zurückgedrängt. Da war eine objektive, universale Kultur eine willkommene Alternative.
Rudolf Serkin (1903-1991), Schüler von Schönberg, musste 1933 nach USA emigrieren, prägte dort das Curtis Institute of Philadelphia, Mitgründer des Marlboro-Musikfestivals. Spielte 1945 - 1975 eine zentrale Rolle in der US-Musikkultur. Trat zweimal im Weißen Haus bei John F. Kennedy auf. Sein Spiel war geprägt von einer solchen Klarheit, daß Busoni ihm Anfang der zwanziger Jahre riet, er solle ein wenig 'schmutziger' spielen und ihn nicht als Schüler annahm. Das gilt auch für seine Einspielung der Sonaten op. 109 - 111 von 1967 - 1976. Im Grunde lässt sich von seiner Einspielung wörtlich das gleiche sagen, was 'Romeo und Julia' zu Pollinis Aufnahme geschrieben haben:
op. 110: "Erster Satz wunderbar leicht und durchdacht, differenziert, schöner Zusammenhalt. Der zweite Satz ebenfalls differenziert und schön, schnörkellos, perlend. Der Schlusssatz klar strukturiert, perlend, steigernd eruptiv, gelegentlich zu auffällig betonte Triller, flüssig, die Fuge ausgeglichen, sehr schön und klar." op. 111: "Schön und Spannungsreich, aber doch mit wunderschönem Spannungsbogen gespielt. Ohne Pathos jedoch mit angenehmer nicht übertriebener analytischer Spielweise vorgetragen. Eine wunderbare Einspielung." Wolfram ergänzt, "dass Pollini im 2. Satz auf geheimnisvolle Weise nichts 'macht' und gerade dadurch alles gewinnt, gerade in den Trillervariationen und in den Abschnitten in höchster Lage."
Damit treffen sie das Ideal dieser Richtung, als deren Meister sich Maurizio Pollini (geb. 1942) erwiesen hat. In Deutschland und Italien kam diese Musikauffassung vielen sehr recht, die jetzt die eigene Tradition und die Auseinandersetzung mit ihr vermeiden wollten und sich gerne aufgehoben sahen in einer neuen globalen Welt. Es gehört zu den Paradoxien der neueren Interpretationsgeschichte, dass gerade in Italien führende Vertreter dieser Richtung dennoch der Linken nahestanden.
Geradezu erschütternd, dass diese Strömung eine solche Macht gewann, dass selbst eigenwillige Pianisten wie Richter ihren typischen Stil aufgaben und sich anschlossen.
Svjatoslav Richter, 1991: Ein größerer Gegensatz als zu seiner eigenen Einspielung von 1963 läßt sich kaum denken. op. 111: Der 1. Satz ist enttäuschend. Im 2. Satz gelingt ihm in der 3. Variation bisweilen ein so noch nicht gehörter ungewöhnlicher Rhythmus. Und dann geht er in der 4. Variation nicht so im Tempo zurück wie die meisten anderen Interpreten, hier beginnt etwas Eigenes. In einer ersten Annäherung würde ich es als Abgeklärtheit beschreiben, besonders in der 5. Variation. Es kommt aber auch ein Gefühl der Leere und Ausgebranntheit hinzu. Das ist jetzt sicher zu hart gesagt, aber in diese Richtung scheint es mir zu gehen. Nur in diesem Sinn kann ich in dieser späten Interpretation eine gewisse Kontinuität zu der früheren Aufnahme von 1963 erkennen.
Gesang aus weitem Herzen (Tatiana Nikolayeva, 1987)
Tatiana Nikolayeva (1924-1993) lernte bei Goldweiser. Schülerin und Professorin am Moskauer Konservatorium. Enge Zusammenarbeit mit Schostakowitsch, der ihr die 24 Präludien und Fugen widmete. Schwerpunkte: Bach, Beethoven. Starb 1993 nach einem Zusammenbruch bei einem Konzert in San Francisco. Aufnahme vom 18.8.1987 in Salzburg.
Nach all der sich gegenseitig überbietenden technischen Brillianz der sonstigen Aufnahmen aus den 70er und 80er Jahren wirkt sie im ersten Moment langweilig. Ich habe mein Urteil jedoch radikal geändert, seit ich Anfang Januar 2009 in Heidelberg ihren Schüler Mikhail Petukhov hörte. Er hat ihr sein Konzert gewidmet und spielte ihr zu Ehren Bach und Schostakowitsch, zum Schluss ohne jede weitere Zugabe das b-Moll Präludium von Schostakowisch. Das war das letzte Stück, das sie in San Francisco gespielt hatte. Das Spiel war von solcher Konzentration, Mitgefühl und großer innerer Ruhe, wie ich lange kein Konzert mehr gehört habe. Das führte mich zu Nikolayeva zurück.
Der erste Satz atmet eine ungeheure Weite. Ihr gelingt über die vielen Steigerungen eine durchgehende Gesangslinie, so dass die abrupten Unterbrechungen in der Durchführung noch schmerzlicher klingen als sonst. Das erzeugt eine ungeheure Dynamik, wobei sie jedoch so viel wie möglich Spannung herausnimmt. Sie versteht diesen Satz nicht als einen letzten Kampf oder Aufbäumen gegen das Schicksal, sondern als "ein mächtig durchkämpftes Leben im Bilde der Rückerinnerung" (A.B. Marx, Beethoven, Bd. 2, S. 300). Im Vergleich zu anderen Interpreten kann ihr Spiel daher bisweilen wie künstlich gebremst klingt. Wer sich aber ganz von ihrem Rhythmus tragen lässt, wird eine völlig neue Seite des 1. Satzes kennen lernen.
Ebenso ist der 2. Satz äußerst konsequent aufgebaut. In keiner anderen mir bekannten Aufnahme wird so vorsichtig und zartfühlend gespielt, wo sie spürt, wie ungeschützt Beethoven seine Gefühle preisgibt. Das ist bereits in der 3. Variation zu hören, besonders aber in der 5. Variation. Hier entschwebt die Musik nicht in kalte Fernen. Schon in der 2. Hälfte der 4. Variation wunderschöne Ideen: Die Triller klingen fast wie ein Glöckchen-Himmel, aber ohne jeden Kitsch, und anschließend entfaltet sie zum Ende der 4. Variation eine herrliche Melodie, die so rein und selbstverloren klingt, dass sie im Vergleich zu anderen überbetont wirken kann. Sie vermag aus der 4. Variation heraus die Episode zur 5. Variation wie eine große weitere Steigerung zu spielen und zeigt die große innere Nähe dieser Stelle zum 2. Satz von Beethovens 4. Klavierkonzert. Dadurch bewegt sie sich in der 5. Variation von Anfang an auf ganz festem Boden, wo andere Interpreten erst einmal von der extremen Klangwelt der kleinen Episode zurückfinden müssen. Die Melodie wird immer sicherer und bestimmter, die Gefühle kommen mit sich ins reine, und großartig spielt sie im Verlaufe der 5. Variation eine Zusammenfassung aller 3 Sonaten. Wie ich es sonst nur von Bruckner kenne, werden in ihrem Spiel die Ausdruckswelten der letzten großen Variation von op. 109, die fast über-menschliche Steigerung der Fugen Umkehrung am Ende von op. 110 und die Arietta-Melodie übereinander gelagert.
Wildes Geschrei der Vögel (Benedetti Michelangeli, 1990)
Noch rauscht der Vögel wohlbedeutendes
Geschrei her, denn es hat von totem Menschenblut
Das Fett gegessen.
Teiresias in Sophokles "Antigone" 4. Akt, 2. Szene
Der Zorn oder die Bitterkeit eines ganzen Lebens sind zu hören, als Benedetti Michelangeli (1920-1995) nochmals am 10. Mai 1990 in London die Sonate op. 111 spielte. Ihr wollt keine leisen Töne? Versteht nur, wenn euch mit "Musik" das Gehör zerschlagen wird? Auf den Gesang der Vögel zu lauschen heißt "ästhetizistisch"? Dann hört, was mir die Vögel über euch zu sagen haben!
Der 1. Satz wird von so vielen Pianisten in äußerster Härte gespielt, dass nicht gleich das Besondere an dieser Aufnahme zu erkennen ist. Ist Benedetti Michelangeli wie Richter einfach dem großen Strom der technischen Virtuosen erlegen und hat seinen früheren Stil aufgegeben? Nichts mehr erinnert an Chopin. Überall, wo sonst der eine oder andere Pianist eine kleine Passage voller Gefühl spielen möchte, spreizt Benedetti Michelangeli 1990 die Tonfolgen und strebt an, in den kleinen Melodiebögen möglichst alle Töne mit gleichem Anschlag zu spielen, einen reinen maschinellen Klang zu erzeugen. Erst bei mehrmaligem Hören wurde mir das Konzept klar: So muß Beethoven "a la Boulez" klingen. Dies "Ideal" ist bis ins Extrem getrieben. In den Fugati fallen die einzelnen Wiederholungen völlig auseinander. Da entsteht keine "Trümmerlandschaft" (Adorno), sondern eine völlige Beziehungslosigkeit, eine "Freiheit", die zugleich eine "absolute Ordnung" ist, wie es von den Zwölftonkomponisten und Serialisten gefordert wurde. Die Aufhellung in C-Dur wird zur Farce. Der lange Pedalnachklang wird so lange ausgehalten, bis das Publikum die Spannung nicht mehr ertragen kann und in ein wahres "Konzert des Räusperns" ausbricht. Ungewollt passt auch das in das Konzept von Benedetti Michelangeli: ein Hohn auf all die Lehren, die Musik bis an den Punkt zu treiben, wo sie in bloßes Geräusch verendet.
Dass der 2. Satz noch extremer ausfällt, ist schon beim ersten Eindruck unüberhörbar. Wenn die Melodie und ihre Variationen im jeweils 2. Teil in wärmeren Gesang ausklingen, schlägt Benedetti Michelangeli sie hier regelrecht auseinander. Die Steigerung bis in die 3. Variation zeigt kein "Erwachen des Empfindens", keine Wiederkehr innerer Freude bis zum beschwingten "Boogie-Woogie-Rhythmus" (Strawinsky), sondern wachsende Beklemmung und innere Lähmung. Die 3. Variation führt in verzweifelte Krämpfe eines entmächtigten Subjekts, das die Kontrolle über die Koordination seiner Gliedmaßen verloren hat. Wo in der 4. Variation sonst der Sternenhimmel aufstrahlt, erklingt hier ein bizarrer Tanz fremdartiger Wesen, deren Rhythmus dem Menschen völlig zuwiderläuft. Schließlich bleibt nur noch die Hoffnung, endlich von dieser Art von Musik erlöst zu werden.
Potentielle Hörer seien also vorgewarnt. Wer aber zum Beispiel "Holzfällen" von Thomas Bernhard mag, dem dürfte auch diese Einspielung von Benedetti Michelangeli liegen.
Momente von Versenkung (Uchida, 2005)
Mitsuko Uchida, geb. 1948 in Japan, kam 1961 nach Wien und ging 1973 nach London. Das Cover-Foto der CD mit den letzten 3 Sonaten von Beethoven wirkt exzentrisch: Hat sie eine Rolle in einem Regietheater, das ein Stück von Sophokles oder Beckett spielt? Da mischt sich ostasiatisches Flair, Erinnerung an den Existenzialismus und ein Hauch zeitgenössischer Luxus. Wie passt das zu Beethoven, der die große Welt längst enttäuscht aufgegeben hatte und in ärmlichen Verhältnissen lebte, als er diese Sonaten schrieb?
Mit Uchida geht es erstmals um eine zeitgenössische Interpretin. Wie hat sie die letzten 60 Jahre erlebt und wie fließt das in ihr Spiel ein? Lassen sich eigene Erfahrungen bei ihr wiederfinden? Ihr Vater war hochrangiger Diplomat Japans in Berlin in den 30ern bis Kriegsende. Nirgends wird näher davon berichtet. In welcher Weise hat sie sich damit auseinandergesetzt? Die japanische Kultur ist mir nur wenig bekannt. Der auch von Musik handelnde Roman "Mister Aufziehvogel" von Haruki Murakami zeigt, wie auf einer unterbewußten Ebene in der Nachkriegsgeneration Japans die Erinnerung an Kriegsverbrechen und -traumata weiterlebt. Und wie wirkt Europa auf sie (japanisch, deutsch und englisch bezeichnet sie als ihre drei Muttersprachen), die Ost-West-Teilung, die sie in Wien erlebte, und der Umschlag der Swinging Sixties in London in Entäuschung und Drogenmissbrauch, gefolgt vom Punk-Ausbruch und Aufständen in den Ausländervierteln? Uchida hat sich bei all ihren Einspielungen intensiv mit der Entstehungsgeschichte der von ihr gespielten Werke beschäftigt. Was ist von ihrer, von unserer Zeit in ihren Interpretationen zu hören? Lebt sie in einem Elfenbeinturm klassischer Musik, in dem sie zielgerichtet und äußerst erfolgreich ihre Karriere betrieben hat, inzwischen gemeinsam mit Richard Goode Nachfolger von Rudolf Serkin beim Marlboro-Festival geworden ist und nun in jedem Interview betont, wie glücklich sie mit sich und ihrem Leben sein kann?
Die Sonaten op. 109 und 110 bestätigen zunächst diese Bedenken. Lässt das Cover eine Kassandra erwarten, die immer direkt und ungeschminkt die Wahrheit sagt, die keiner hören will, dann verniedlicht sie hier im Gegenteil Beethoven und betont einseitig seine späte Sehnsucht, wieder zu einem Mozartschen Klang zurückzukehren. Es ist sicher psychologisch richtig und nachvollziehbar, dass Beethoven alles infrage stellte, was und wie er bis dahin komponiert hatte und sich bisweilen in schwachen Momenten die vergangene Geborgenheit zurückwünschte, die aus der Musik von Bach oder Mozart zu hören ist. Aber er war sich völlig bewusst und litt tief darunter, dass das vorbei ist. Bei Uchida ist das nicht zu hören. Die tieftraurigen Stellen in op. 110 haben nichts Rauhes. Die Gassenhauer im mittleren Satz klingen harmlos wie auf dem Kirmes. Das mag für das Kätzchen-Lied stimmen, Aber das Lied "Ich bin lüderlich, du bist lüderlich, wir sind lüderliche Leut" war bitter ernst gemeint. Mir scheint, dass sie geradezu Angst hat vor solcher Direktheit.
Op. 111 setzt das fort. Sie spielt den 1. Satz mit ungewohnt wenig Härte. Damit trifft sie den Ton, wie er zu Beethovens Zeiten geklungen haben wird, bevor die Flügel im 19. Jahrhundert immer mächtiger wurden. Ihr Spiel ist nicht hart, aber an manchen Stellen durchaus energisch. Da sehe ich Ansätze, wie dieser Satz anders als früher üblich gespielt werden kann. Aber es gelingt ihr bei weitem nicht, den Satz mit einer solchen inneren Leidenschaft zu spielen wie zahlreiche andere Pianisten.
Im 2. Satz betont sie das Einfache, was ebenfalls den Vorgaben von Beethoven entspricht. Aber für eine solche Herangehensweise ist sie viel zu langsam. Während Beethovens Sinfonien inzwischen wieder entsprechend seinen Metronom-Angaben aufgeführt werden, scheint das für seine Klaviersonaten noch nicht zu gelten. Beethoven gibt in den letzten 3 Sonaten das Tempo zwar nicht vor, aber ein wenig sollte sie sich schon an seinen anderen Werken orientieren.
Dank des langsamen Tempos gelingen ihr jedoch an einigen Stellen Momente der Versenkung, so bereits im Maestoso und auch in der 4. Variation und der berühmten Stelle, die Thomas Mann mit Worten wie "Nun ver-giß der Qual" oder "Bleib - mir hold gesinnt" unterlegt hat. Hier ist zu spüren, dass sie weit mehr zu sagen hat, als sie bisher gezeigt hat. Ich wünsche ihr sehr, dass es ihr gelingen möge, über den Schatten des vorherrschenden Musikgeschmacks zu springen. Das wird sicherlich mit großen Schmerzen verbunden sein, die sie bisher meidet, wird alle Fragen ihres Lebens aufrühren, aber am Ende wie eine Befreiung sein.
Den Weg zu einem romantischen Spiel wieder geöffnet (Andras Schiff, 2007)
András Schiff (geb. 1953), bei seinen Interviews spüre ich sofort etwas Verwandtes. Er fühlt sich der ungarischen Tradition zugehörig (Leo Weiner, Zeitgenosse von Bartok, war Lehrer von Fritz Reiner, Sandor Vegh und Solti, und er wiederum Schüler von Vegh). Ihm ist wichtig, das Klavier zum Singen zu bringen. Die Musik soll atmen. Ausgehend von Schuberts singender Musik. Horszowski als Vorbild. Gegen die amerikanische Kultur, die alles laut und plakativ zeigen will und keiner leisen Individualität Räum läßt. Gegen den "Realismus" des 20. Jahrhundert, der alles nackt und hässlich zeigen will, ganz anders als etwa Schubert im "Leiermann". Bevorzugt Bach und alles, was sich auf Bach bezieht, spielt daher nicht Liszt, Ravel oder Rachmaninov. Hier kann ich ihm allerdings nicht mehr folgen. Interview
Höhepunkte seiner Einspielung der letzten 3 Sonaten sind denn auch die beiden Fugen in den Finalsätzen von op. 109 und op. 110 sowie die Fugati im 1. Satz von op. 111. Wie schon bei Gould und Nikolayeva wirken sich die Erfahrungen mit der Musik von Bach sehr positiv aus und geben große Sicherheit.
Nach den Jahrzehnten, in denen immer größere Klarheit und fast wissenschaftliche Strenge, äußerste technische Präzision und möglichst genauer Gleichklang und Ausgewogenheit verlangt waren, die Tempi immer langsamer und alle Feinheiten immer deutlicher wurden, will er wieder Bewegung hinein bringen und die Töne klingen lassen. An der Musik soll wieder das zu hören und zu spüren sein, was sich nicht aus bloßer Lektüre des Notentextes ergibt.
Bei jedem Takt und jeder Phrase kann ich nachvollziehen, was er sich dabei gedacht hat. Und doch bleibt immer noch eine große Kontrolle zurück. Es scheint, als hätte er Angst, den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das zeigt sich besonders im 2. Satz von op. 111, aber auch schon in op. 109. Am wenigsten verstehe ich, welch eigenartigen Anschlag er bisweilen in den beiden schnellen mittleren Sätzen von op. 109 und 110 wählt (z.B. op.109/2, 00:06 - 00:16).
Trotz des 2. Satzes gefällt mir aber op. 110 am besten, und dort besonders der letzte Satz. In keiner anderen Aufnahme ist der schwierige Übergang zur Umkehrung der Fuge so gut gelungen. Er vermeidet sowohl ein falsches übertriebenes Gefühl wie auch Oberflächlichkeit oder Gefühllosigkeit. Hier ist am deutlichsten zu erkennen, in welche Richtung er gehen will. Nachdem in den letzten 50 Jahren das frühere romantisierende Spiel als schwülstig, überladen und altbacken abgelehnt worden war, ist nun vorsichtig ein Weg zurück in eine romantische Auffassung zu finden, ohne einfach das zu wiederholen, wie früher gespielt wurde. Das ist äußerst schwierig, und wohl niemand hat heute ein klares Konzept, wie das gelingen kann. Auch Andras Schiff hat noch bei weitem nicht das erreicht, was es einmal sein wird, aber er hat mutig den Weg dorthin eröffnet.
'Weitermachen' auch in 'wüsten Zeiten' (Alexei Volodin, 2004)
Diese Aufnahme ist zwar bereits 2004 und damit vor den Einspielungen von Uchida und Schiff entstanden, aber ich möchte diese Reihe abschließen mit dem jüngeren, 1977 geborenen Alexei Volodin. Er ist ein Schüler von Elisso Virsaladze (geb. 1942) und stellte bei seinem Debut in München die Sonate op. 111 nicht ans Ende, sondern an den Anfang, um sich dann über Rachmaninov "Moment Musicaux" op. 16 und Prokofjews 7. Sonate der Gegenwart zu nähern. Der Bogen reicht also vom Maestoso bei Beethoven bis zum Precipitato von Prokofjew. Bei Prokofjew ist seine eigene Stimme besonders deutlich zu hören. Dort sind das ungewöhnliche Rhythmus-Gefühl, vor allem die oft eine wunderbare Bass-Linie spielende linke Hand, und die glöckchenhaft hellen Töne zu bewundern. Geradezu mitreißend der von Anfang bis Ende durchgehaltene Rock-Rhythmus im Precipitato. Aber auch der langsame Satz bei Prokofjew wird von ihm in einer ganz neuen Art gespielt. Das ist für mich einer der innerlich bewegendsten Sätze der Musik, der hier ganz ungewohnt erklingt.
Darf dieses Stück so gespielt werden? Die 7. Sonate von Prokofjew hat für die russische Musik eine ähnliche Bedeutung wie Beethovens op. 111 für die deutsche. Sie ist sogar noch stärker politisch gedeutet. Andrei Gavrilov: "Um die künstliche, hohle Fröhlichkeit der sowjetischen Jugend zu parodieren, führt Prokofjew im ersten und im dritten Satz ein 'Pionier-Motiv' ein, das die kindlichen Monster charakterisiert, die Verwandte denunzieren, sich als 'Helden' fühlen und die offizielle Propaganda als Wahrheit proklamieren. ... Das Finale der siebten Sonate ist eine Apotheose der Gewalt - der schonungslosen, mechanischen und methodischen Zerstörung allen Lebens."
Volodin scheint das alles wegzuwischen. Er trifft das Lebensgefühl der damaligen Pioniere, der in den 1920ern und 1930ern nach der Revolution geborenen Generation, die heute in tiefer Verbitterung vor den Trümmern ihrer Gesellschaft und ihrer früheren Ideale stehen, weit besser als andere Interpreten. So entwickelt sich von innen her auf ganz andere Art die Dramatik, gibt aber die Möglichkeit eines späten Verständnisses, ja Versöhnung, ohne dadurch irgendetwas zu beschönigen, statt bei Vorwürfen und Verhärtung stehen zu bleiben. Einen solchen Weg zu suchen, das bedeutet "Weitermachen auch in wüsten Zeiten".
Unter diesem Titel hat Jost Hermand 1999 einen Artikel im "Archiv für Musikwissenschaft" veröffentlicht, um Beethovens Sonate op. 111 aus der aus seiner Sicht unheilvollen Verstrickung zu lösen, in die sie seit den Beiträgen von Adorno und Th. Mann geraten ist. Er sieht in ihr gerade umgekehrt den Versuch, in einer nach-revolutionären Zeit Kraft zu geben und vor Resignation zu bewahren. Beethoven hatte eine schwere Krise durchgemacht. Hermand zitiert aus einem Brief an Dr. Kranka in Prag von 1817: "Übrigens macht einen alles um uns nahe her ganz verstummen." Doch ist es Beethoven gelungen, sich daraus wieder zu befreien, trotz aller widrigen Umstände wie der weiter fortschreitenden Taubheit, der Konflikte mit dem Neffen und der Isolierung in der Wiener Gesellschaft. Beethoven schrieb am 29.7.1819 an den Erzherzog Rudolph: "Weitergehen ist in der Kunstwelt wie in der ganzen großen Schöpfung Zweck."
Von hier aus interpretiert Hermand die Sonate op. 111. Der 1. Satz ist für ihn eine Reminiszenz an vergangene revolutionäre Gefühle, der 2. Satz steht im leuchtenden C-Dur und wählt mit der Arietta eine bewußt einfache und volkstümliche Melodie, um die eigenen Gefühle wieder zu sammeln.
Und das ist für mich nirgends so gut zu hören wie bei Volodin, der an die Beethoven-Sonate mit der gleichen Grundhaltung herangeht wie an Prokofjew. Die vertrackten Tempowechsel des 1. Satzes sind ungewöhnlich souverän genommen. Einzelne Töne sind oft wie hingelegt, und geben ihrer Umgebung Gewicht und Halt.
Wo andere Interpreten Beethoven im 1. Satz die früheren Kämpfe gegen das Schicksal noch einmal austragen oder mindestens wie ein Echo nachklingen lassen, bricht bei Volodin immer wieder eine lebendig sprudelnde Frische durch, die neu Mut schöpfen läßt. Der 2. Satz folgt daher nicht abrupt und etwas unglaubwürdig, sondern wie selbstverständlich erklingt die Arietta-Melodie, deren Schlichtheit die Kraft gibt, wieder zu innerer Freude und Ausgeglichenheit zurückzufinden, ohne die vorangegangene Verzweiflung einfach zu verdrängen.
Vollständige Desintegration bis zum jähen Ende (Soldan, 2013)
Christoph Soldan hat eine ganz eigene Deutung der Sonate op. 111 gefunden. Er spielt den ersten Satz wesentlich zurückhaltender und langsamer als gewohnt. In den großen Steigerungen sind keine verzweifelten Kämpfe oder gar Schlachtenmalereien wie in manchen anderen Aufnahmen zu hören, sondern wie aus großer Ferne ein Rückblick auf das Leben, das so viele Kämpfe gefordert und so viel Kraft gekostet hat, ohne jemals zu einer endgültigen Entscheidung gekommen zu sein. Anders ist wohl kein Leben möglich, jede neue Generation wird das neu durchmachen müssen, doch der Komponist zieht sich davon zurück, nicht weil er es so will, sondern weil er anders nicht mehr kann.
Fast unvermutet schlägt dennoch der eine oder andere Ton in voller Härte herein, bleibt jedoch isoliert für sich stehen. Stattdessen gewinnen die vorsichtigen Passagen größere Bedeutung, in denen Beethoven auf die innere Stimme zu hören scheint, den Schmerz, der am Ende als einziges übrig bleibt und seine eigene Schönheit gewinnt. Aus ihnen entwickelt sich übergangslos der zweite Satz.
Leeren Musik-Formaten gleich sind die Techniken zu hören, die früher Emotionen auszudrücken vermochten, sei es der Boogie-Woogie-Rhythmus in der 3. Variation oder die Klangfarben der 4. Variation. Der Komponist hört das alles noch, doch wirkt es eigenartig verblasst oder verblasen. Möchte Soldan hören lassen, wie der ertaubte Beethoven Musik noch hat wahrnehmen können?
Die Formen werden auf bloße Schemen reduziert. Das hatte bereits Beethovens Sekretär Anton Schindler gespürt, als er bei dieser Sonate vom "Übermaß von Wissenschaftlichkeit" sprach. In den Zwischenräumen der leer gewordenen Struktur entsteht eine eigene Musik, völlige Innerlichkeit. Wiederholt bleibt der Musikfluss nahezu völlig stehen, als versuche der Komponist, sich in der neuen, auch für ihn noch ungewohnten Umgebung zu orientieren. Aber selbst dieser Orientierungsversuch scheint wiederum nur ein kraftlos gewordenes Schema zu sein, das keinen inneren Zusammenhang mehr zu geben vermag.
Ein letztes Mal scheint sich die Musik im Übergang von der 4. zur 5. Variation in ein Stück konsolidieren zu können, wie es der Tradition entspricht. Soldan betont die Noten, denen Thomas Mann im Roman "Doktor Faustus" die Worte "Him-melsblau, Lie-besleid, Leb'-mir wohl, Der-maleinst, Wie-sengrund" unterlegt hatte, als entstünde hier mitten aus der Desintegration heraus doch noch ein Werk im klassischen Beethovenschen Stil, der oft mit ähnlich einfachen Phrasen begonnen hatte (am populärsten die 5. Sinfonie), um es dann um so deutlicher wieder versinken zu lassen. Das ist der endgültige Abschied Beethovens von seinem eigenen Werk. Während andere Interpreten – wie zum Beispiel großartig Tatiana Nikolayeva – einen Gesang folgen lassen, der das Stück in ganz ungewohnte Höhen trägt, nimmt Soldan den Ausdruck völlig zurück. In einem einleitenden Beitrag erklärte er, dass die Musik jede Richtung verliert und keiner mehr sagen kann, wohin sie sich entwickeln wird. Das Ende kommt völlig abrupt. Soldan versucht nicht, zum letzten Ton hin eine ausklingende Linie zu gestalten, sondern spielt ihn so, als habe Beethoven mitten bei der Arbeit das Werk jäh unterbrochen. Die völlige Einsamkeit des Todes.
Aufnahmen
Claudio Arrau (1965?) 9'12'' und 19'40'' Philips
Wilhelm Backhaus (1954) 7'57'' und 13'05'' Andromeda
Arturo Benedetti Michelangeli (1961) 8'40'' und 16'34'' BBC Legends
Arturo Benedetti Michelangeli (1990) 9'35'' und 16'54'' Aura
Walter Gieseking (1937) 5'55'' (o.W.) und 13'55'' Archipel
Glenn Gould (1956) 7'15'' und 15'15'' CBS
Maria Grinberg (1966) 9'22'' und 16'50'' Melodya
Youra Guller (1973) 10'24'' und 18'34'' Erato
Wilhelm Kempff (1953) 7'05'' (o.W.) und 14'30'' DGG
Yves Nat (1954) 6'20 (o.W.) und 14'01'' EMI
Tatiana Nikolayeva (1987) 9'50'' und 18'08'' Orfeo
Maurizio Pollini (1977) 8'47'' und 17'23'' DGG
Svjatoslav Richter (1963) 8'08'' und 15'35'' Music & Arts
Svjatoslav Richter (1991) 8'48'' und 16'14'' Philips
Andras Schiff (2007) 8'42'' und 18'03'' ECM
Artur Schnabel (1932) 8'20'' und 17'48'' EMI
Rudolf Serkin (1967) 9'00'' und 17'56'' CBS / Sony
Vladimir Sofronitsky (1952) 6'40'' (o.W.) und 16'21'' Urania
Solomon (Cutner) (1951) 8'42'' und 17'55'' EMI
Mitsuko Uchida (2005) 9'21'' und 18'35'' Philips
Alexei Volodin (2004) 8'57'' und 16'40'' Live Classics
Maria Yudina (1951) 9'13'' und 13'43'' Vista Vera
Die Zeitangaben sind bisweilen irreführend, wenn im 1. Satz die Wiederholung nicht gespielt wurde oder im 2. Satz der Beifall mitgezählt wird. Insgesamt zeigt sich, in welchem Maß immer langsamer gespielt wird, nachdem bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts das Tempo stark zurückgenommen worden war.
Eine umfangreichere Diskographie (ca. 80 Aufnahmen) mit Bewertungsnoten und einigen Kommentaren: Klassik-Prisma
2008-2009, 2013
Weitere Texte zum Thema
Die Entstehung des Mythos "opus 111"
Schatten und Sternenlicht über Musik-Trümmern (Adorno)
Musik im technischen Horizont (Thomas Mann "Doktor Faustus")
© tydecks.info 2009 - Erstveröffentlichung einiger Teile im Tamino-Klassikforum von November 2008 bis März 2009